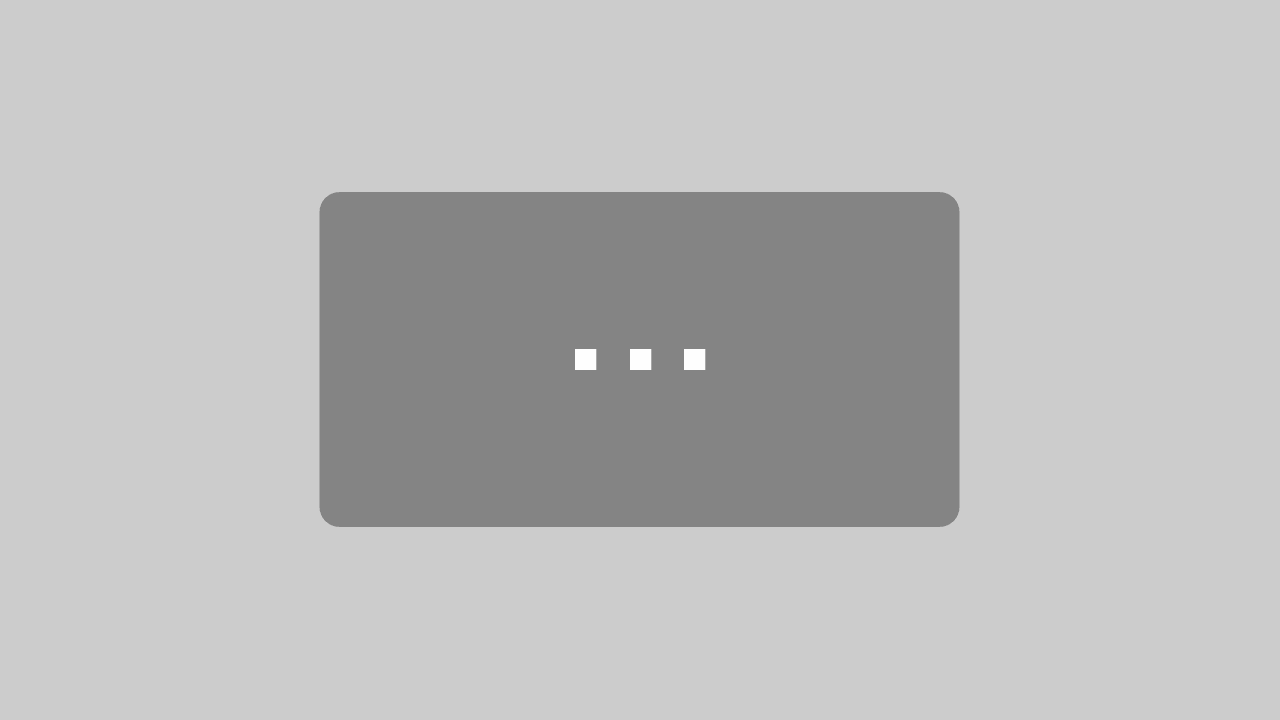Neulich stolperte ich über ein YouTube-Video einer jungen Amerikanerin, die in zwei, drei Sätzen erwähnte, dass sie wieder mit einer depressiven Episode zu kämpfen hat. Ihre Worte lösten in mir gleichermaßen Mitgefühl als auch Verständnis und Erleichterung aus, weil da schon wieder eine Person war, der es ähnlich ging, wie mir und die sich nicht davor scheute, auch darüber zu sprechen. Mittlerweile werden Depressionen und Angststörungen — glücklicherweise — in Zeitungen, Magazinen, TV-Serien und, ja, selbst in den sozialen Medien thematisiert und machen nicht bloß darauf aufmerksam, dass es sie gibt, sondern auch, dass sie für manche Menschen zum Leben dazugehören. Wie aber bringt man Themen wie psychische Erkrankungen an Orte, an denen sie oftmals noch tabuisiert werden? Etwa, wenn es um die alltägliche Arbeit in einem Unternehmen geht? Genau an diesem Punkt setzt Shitshow, eine Berliner Agentur für psychische Gesundheit, die von Nele Groeger, Johanna Dreyer und Luisa Weyrich gegründet wurde, an. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus Psycholog*innen, BGM- und HR-Expert*innen beraten die drei Gründerinnen Unternehmen und Organisationen in Sachen Wiederherstellung und Erhalt der psychischen Gesundheit. Entstanden ist die Agentur aus einem gemeinsamen Uni-Projekt, der Ausstellung „Shitshow — a show about shitty feelings“, die nicht-Betroffenen Angststörungen und Depressionen anhand von eigens entwickelten „Mood Suits“ näher bringen sollte.
Wir haben die Frauen hinter Shitshow getroffen und mit ihnen über Scheißgefühle, psychische Gesundheit und Yogakurse gesprochen.
In eurer Arbeit, aber auch in eurem Studium habt ihr euch dazu entschlossen, mit dem Thema psychische Gesundheit zu arbeiten — was hat euch angetrieben, diesen Weg einzuschlagen?
Nele: Wir haben uns im Studium kennengelernt und sind eigentlich relativ schnell über Gespräche und unsere Freundschaften dahinter gekommen, dass wir selbst auch eigene Geschichten zu dem Thema haben. Ich habe Erfahrungen mit Depressionen, Johanna mit Angststörungen und Luisa hat Erfahrungen mit Johanna und mir. Es war also immer ein Thema unter uns Freundinnen. Im Studium kam noch hinzu, dass wir uns innerhalb der Kommunikations- und Sozialpsychologie mit dem sogenannten Embodiment-Konzept beschäftigt haben. Dabei geht es darum, wie sich Gefühle im Körper ausdrücken und andersrum – in diesem Zuge sind auch unsere Mood Suits entstanden. Durch die Beschäftigung mit dem ganzen Thema haben wir gemerkt, dass wir uns in unserem persönlichen Arbeitsumfeld nicht immer gut gefühlt haben und dass es noch eine ganze Menge zu tun gibt, wenn es darum geht, wie man Menschen, die psychisch belastet sind, unterstützen kann, aber auch, wie man psychische Gesundheit erhalten kann.
Luisa: Wir haben gemerkt, dass dieser Austausch, den wir als Freundinnen haben, total guttut, er auf der Arbeit aber absolut nicht stattfindet. Da wird die gesamte Thematik tabuisiert. Damals habe ich noch in einer Strategieagentur gearbeitet, in der es eher gefeiert wurde, hart zu arbeiten. Manchmal habe ich schon gemerkt, dass es mir zu viel wird, aber getraut, etwas zu sagen, habe ich mich nie. Das war schon eine krasse Diskrepanz zwischen den beiden Welten. Genau da haben wir gemerkt, dass sich etwas ändern muss. In diesen Firmen braucht es einen Kulturwandel, der die psychische Gesundheit mehr in den Blick nimmt und deren Schutz auch will. Das war der Ausgangspunkt für unsere Agentur. Wir haben also überlegt, was man machen könnte, um diesen Wandel anzustoßen.
Auf eurer Webseite heißt es, dass Shitshow eine Kommunikations- und Beratungsagentur für psychische Gesundheit ist. Wie genau kann ich mir eure Arbeit vorstellen?
Luisa: Wir haben viele verschiedene Formate und arbeiten nach wie vor mit unseren Mood Suits, also Objekten, die Symptome psychischer Erkrankungen für Menschen, die bisher keine Berührungspunkte mit ihnen hatten, erfahrbar zu machen. Letztlich geht es uns darum, erste Veränderungsprozesse in Unternehmenskulturen anzustoßen.
Johanna: Es geht uns etwa darum, wie man das Thema psychische Gesundheit überhaupt platziert, weil es natürlich kompliziert ist und gleichzeitig überall aufploppt. Deshalb haben wir beispielsweise einen Talk entwickelt, um erst einmal verständlich zu machen, was es überhaupt bedeutet, wenn man sich Mental Health ins Unternehmen holt und wo man da ansetzen muss. In erster Linie machen wir einen Überblick, eine Art Map, die aufzeigt, wie das Unternehmen aussieht und wo die verschiedenen Stellschrauben sind, an denen man drehen kann.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Zielt ihr mit euren Angeboten auf Unternehmensleiter*innen oder auf Mitarbeiter*innen ab?
Johanna: Ohne eine Führungskraft, die da mit anpackt, geht es nicht. Es geht aber auch nicht ohne die Mitarbeiter*innen. Auf diesen unterschiedlichen Ebenen muss man erst mal Wissen aufbauen und Empathie füreinander bekommen, denn natürlich kann es auch mal sein, dass eine Person ausfällt und das Arbeitsvolumen dann von anderen Kolleg*innen übernommen werden muss. Wir geben Workshops, die Führungskräfte schulen, bieten aber auch ein Mitarbeitertraining an, bei dem es wirklich um die Kommunikation geht, also wie man solche Gespräche überhaupt führen kann. Da geht es letztlich auch darum, Dinge an sich selbst zu erkennen. An all den unterschiedlichen Stellen setzen wir mit verschiedenen Formaten an.
Ihr habt erwähnt, dass ihr die Mood Suits mitnehmt — wie werden sie in solchen Workshops angenommen?
Luisa: Die Mood Suits funktionieren auf jeden Fall immer. Diese merkwürdigen Objekte sind von Anfang an im Raum und wir merken dann schon, dass die Leute auf sie schielen und sich fragen, wann sie diese endlich anfassen können, weil sie von ihrer Formsprache natürlich auch ulkig sind. In unserem zweiten Projekt, das sich in der Bildungsarbeit bewegt, arbeiten wir mit Kindern und sind auch dort immer wieder erstaunt, wie gut es bei ihnen funktioniert, ohne die Konstrukte wie Depressionen oder Angststörung zu benennen und es lediglich über die körperliche Ebene zu thematisieren.
In eurem Ted Talk habt ihr davon gesprochen, dass psychische Erkrankungen nicht die Geschichte einer einzelnen Person, sondern die Geschichte von vielen ist
Luisa: Ja, ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist es, keine Grenze zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen zu ziehen. Wir möchten Formate machen, die sich an alle richten. So ist auch unsere Ausstellung „Shitshow — A show about shitty feelings“, also eine Ausstellung über Scheißgefühle, entstanden. Die Gefühle sind der kleinste gemeinsame Nenner, mit dem sich jeder identifizieren kann. Eine Ausstellung zu Depressionen und Angststörungen hätte hingegen all diejenigen, die nicht betroffen sind, nicht unbedingt angesprochen. Auch in unseren Formaten, die wir in Unternehmen anbieten, geht es darum, alle abzuholen, zu sensibilisieren und zu informieren. Noch dazu erkranken 28 Prozent der erwachsenen Menschen jährlich an einer psychischen Krankheit. Im Prinzip ist es also etwas, das jeden etwas angeht, auch wenn er / sie sich vermeintlich als unantastbar fühlt.
Was würdet ihr einer Person raten, die unter einer psychischen Krankheit leidet und auf der Arbeit gerne darüber sprechen würde, aber nicht weiß, wie und ob sie es überhaupt ansprechen kann.
Nele: Es gibt ja immer diese zwei Tendenzen. Zum einen gibt es die Bewegung, die sagt, es müsse auf jeden Fall von allen darüber geredet werden und dass es total wichtig sei, dass sich jetzt alle öffnen. Wir selbst sind da aber immer etwas vorsichtiger, weil es natürlich ein sehr komplexes Problem ist und von unfassbar vielen Faktoren abhängt. In einer Unternehmenskultur, in der es keinen Raum für psychische Erkrankungen gibt, würden sich Betroffene durch einen offenen Umgang natürlich extrem verletzbar machen und sich in eine Risikosituation begeben. Deshalb ist es letztlich immer eine ganz starke, individuelle Abwägung, ob man es wirklich sagen möchte. Natürlich gibt es mittlerweile immer mehr Menschen, die sich öffnen, aber es greift häufig auch mit der Bereitschaft der Führungsebene, das Thema im Unternehmen zu platzieren, ineinander. Es ist also eine Bewegung, die aus verschiedenen Richtungen kommt. Mit unserer Arbeit möchten wir diesen kulturellen Impuls setzen. Ich glaube, dass sich mit diesem Start auch Türen für Betroffene öffnen. Zu versuchen, brachial durch verschlossene Türen zu gehen, macht keinen Sinn, denn es ist nach wie vor leider so, dass Betroffene — vor allem in konservativen Unternehmen — mit Nachteilen rechnen müssen. Sei es, dass sie als weniger leistungsfähig eingestuft werden oder dass ihr berufliches Fortkommen eingeschränkt wird. Das möchten wir natürlich keinesfalls fördern.
Johanna: Es gibt da auch diesen schönen Begriff „Psychologische Sicherheit“, der sich genau auf den erstrebenswerten Zustand, solche Dinge ansprechen zu können, ohne, dass etwas passiert, bezieht. Diesen Zustand muss man in Unternehmen natürlich auch erst mal herstellen, denn real gesehen gibt es noch immer Führungspositionen, die Betroffene schnellstmöglich loswerden wollen.
Luisa: In unserer täglichen Arbeit bekommen wir ja wirklich mit, welche Stigmata noch kursieren. Wir haben da schon so was wie „Der / die simuliert doch nur“ oder „Jetzt reiß dich zusammen“ gehört.
Nele: Der Profit- und Effizienzdruck ist teils so derartig stark, dass manche Unternehmensführungen versuchen, Menschen bereits im Bewerbungsgespräch auszusieben und zu erkennen, welche Person betroffen ist. Das sind Kultur- und Wertefragen, hinter denen ganz viel steckt, etwa welche Menschenbilder und welche Leistungsbilder eine Kultur hat.
Also müssen sich Unternehmen zuerst öffnen und Angestellten das Gefühl von Sicherheit geben?
Luisa: Ja. Um noch mal eine Zahl zu nennen: Acht von zehn betroffenen Leuten, die in einem festen Anstellungsverhältnis arbeiten, würden sich gerne öffnen, trauen sich aber nicht, weil sie Angst vor einer Kündigung, einer Stigmatisierung oder davor, dass ihre Leistungsfähigkeit angezweifelt wird, haben. Ich glaube also schon, dass die Bereitschaft von Betroffenen, sich zu öffnen, oft da ist, aber das Umfeld oftmals einfach nicht stimmt.
Nele: Es gibt auch Beispiele dafür, wie sich Betroffene im Unternehmen zu sogenannten Employee Resource Groups zusammenschließen, sich gegenseitig empowern und somit eine Stimme im Unternehmen haben. Aber auch das ist häufig natürlich erst mal von der Führungsebene initiiert.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Foto: Alena Schmick / @alena_schmick
Habt ihr denn selbst schon Ablehnung erfahren, als ihr euch vor anderen geöffnet habt?
Johanna: Zwar nicht direkt Ablehnung, aber Unverständnis gab es auf jeden Fall eine ganze Menge. Schon in Freundschaften ist es super schwierig, Dinge zu empfinden, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn es beispielsweise um Angst geht, sind es ja auch wirklich irrationelle Situationen. Erkläre deiner Freundin mal, dass du jetzt nicht U-Bahn fahren kannst, weil du darin Todesangst verspürst. Solche Übersetzungsprozesse haben viele Freundschaften auf die Probe gestellt.
Nele: Ich würde auch auf diese impliziten, negativen Folgen gehen, denn expliziert wurde es mir nie kommuniziert. Als Agentur, aber auch als Gründerinnen bewegen wir uns natürlich aber auf einem sehr schmalen Grat zwischen — überspitzt gesagt — Opfern und Experten.
Johanna: Entstigmatisierungsarbeit ist auch emotionale Arbeit. Wenn man mit solchen Dingen an die Öffentlichkeit geht, gibt es auch diesen kritischen Moment, in dem einem bewusst wird, dass es jetzt da draußen ist. Das sind die Momente, in denen sie emotional sichtbar werden und man sich denkt „Okay, das könnte jetzt irgendwann mal potenziell Nachteile geben“.
Wie geht ihr mit diesen Risiken um?
Johanna: Wir machen es dennoch bewusst, bewahren aber auch gewisse Grenzen, weil es nicht darum geht, unsere persönliche Geschichte zu erzählen, sondern um die Systeme, in die wir reingehen. Das heißt, wir nutzen unsere Expertise als Tool, um zu sensibilisieren und um Empathie und Verständnis für diesen Zustand zu gewinnen.
Nele: Das unterscheidet uns in den Medien ja auch von klassischen Influencer-Figuren. Sich mit der eigenen Erfahrung zu exponieren, kostet extrem viel Arbeit, die wir emotional weder abfangen noch leisten könnten.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Was würdet ihr einer Person raten, die sich öffnet, dann aber Ablehnung erfährt?
Nele: In solchen Momenten muss man ganz viele Ressourcen aus sich selbst und dem näheren sozialen Umfeld akquirieren und sich — sei es mithilfe einer beratenden Person — ins Bewusstsein rufen, dass die Wunde, die da hinterlassen wurde, nicht die eigene Schuld ist, sondern etwas, mit dem genau dieser Mensch in diesem Moment nicht umgehen konnte.
Luisa: Genau. Man muss sich überlegen, wie viel die Ablehnung überhaupt mit einem selbst zu tun hat und wie viel mit der anderen Person, womit wir auch ganz schnell beim Thema Selbstempathie wären. Es ist aber super schwierig, das so aufzudröseln.
Lasst uns noch mal über die Unternehmen sprechen. Wo liegen eurer Erfahrung nach noch die größten Probleme in Unternehmen? Betrifft es eher die Kommunikation, die allgemeine Offenheit gegenüber dem Thema oder vielleicht Unwissenheit?
Luisa: Ich würde sagen, es ist eigentlich so ziemlich alles, das du gesagt hast. Viele Unternehmen erkennen mittlerweile, dass es thematisiert werden muss. Der nächste Schritt ist dann oft eine extrem große Unsicherheit. Viele starten mit einem Wissensaufbau, etwa durch E-Learning-Programme, was ja erst mal gut ist.
Johanna: Ich glaube, es kommt ganz stark auf die Unternehmensgröße an. In kleinen Unternehmen ist es leichter, weil man viel stärker in Kontakt steht. Je größer das Unternehmen wird, desto weniger haben einzelne Personen Kontakt zueinander. Da sind die Stellschrauben also noch mal ganz anders.
Nele: Ich glaube, alle Bewegungen, die sich für einen Kulturwandel im Unternehmen stark machen, müssen sich erst mal beweisen. Da ist natürlich auch ein hoher Kosten- und Effizienzdruck dahinter. Man muss stark gegen Wirtschaftshardliner ankämpfen und erklären, dass es etwas Tolles ist — und zwar nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für das Unternehmen.
Johanna: Natürlich sind auch ganz oft Ängste, ob die Leistung noch erbracht wird, vorhanden. Es ist ja logisch, dass Firmen auch immer den Produktivitätsdruck im Nacken haben. Da ist sehr viel Aufklärungsarbeit zu tun.
Und wie wird eure Arbeit von Unternehmen angenommen?
Luisa: Gut. Wir hatten eigentlich noch nie jemanden, der später gesagt hat: „Oh Gott, was habt ihr denn da gemacht, warum haben wir euch nur gebucht?“. Wir merken aber, dass noch Unsicherheit besteht. Zum Beispiel, wenn uns Leute anfragen, und zwar finden, dass unsere Arbeit spannend klingt, sich später aber doch einen Resilienzcoach holen, also lieber das Wellness-Programm, als die Shit Show, die über Scheißgefühle spricht, wählen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Liegt es daran, dass es leichter ist, Mitarbeiter*innen eine wöchentliche Yoga-Stunde zur Verfügung zu stellen, die noch dazu ein tolles Image hat? Wenn ich hingegen über psychische Erkrankungen spreche, bekenne ich mich dazu, ein „Problem“ zu haben?
Nele: Absolut. Wir sagen immer, dass es die Büchse der Pandora ist. Erwiesenermaßen ist diese Angst aber unberechtigt, weil Aufklärungsbewegungen ja eigentlich dafür sorgen, dass man mit solchen Dingen umgehen kann. Trotzdem ist da erst mal eine Schwierigkeit, sich diesem Problem anzunehmen.
Johanna: Das ist auch der Unterschied zu Yogakursen. Wenn du als Führungskraft einen Yogakurs zur Verfügung stellst, ist ganz klar, wer etwas machen muss, wer etwas bekommt und wer etwas bezahlt. Wenn man sich jetzt aber wirklich die Kultur ansieht, wird die Verantwortung aufgeteilt und man merkt im Zweifel, dass man auch an der eigenen Verhaltensweise etwas ändern muss. Ich glaube, es braucht auch ein bisschen Mut, sich der Verantwortung anzunehmen.
Luisa: Das knüpft auch ein bisschen an einer weiteren Mission von uns an: Self Care ist derzeit ja total im Kommen, ganz egal, ob es um Beauty oder die seelische und psychische Gesundheit geht. Wir möchten uns allerdings von Self Care zu Common Care bewegen. Es ist die solidarische Idee, dass alle in Verantwortung gezogen werden.
Psychische Gesundheit ist ja ein Thema, das verstärkt auch in den sozialen Medien stattfindet. Auf Instagram gibt es etwa immer mehr Accounts, die sich mit Mental Health befassen und es ästhetisch aufbereiten. Auch euer Instagram Account hat einen ästhetischen Anspruch — braucht es heutzutage diesen Designaspekt, um Menschen zu erreichen?
Johanna: Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass sich Menschen immer stärker über ästhetische Werte definieren. Im Buch „Der ästhetische Kapitalismus“ geht es etwa darum, dass man Dinge nicht mehr nur wegen des Gebrauchswerts kauft, sondern weil sie mit einer Atmosphäre aufgeladen sind. Das muss auch gar nicht nur visuell sein, das können auch Text, Gestaltung und Person betreffen. In der Gesellschaft orientieren wir uns stark durch diese ästhetischen Atmosphären, positionieren uns gleichzeitig aber auch durch sie. Mit einer Tasse kann ich zum Beispiel auch aussagen, dass ich ein designbewusster Mensch bin. Als wir angefangen haben, an der Shitshow zu arbeiten, haben wir gesehen, dass psychische Krankheiten ganz oft Schwarz und Weiß dargestellt werden. Da sitzt dann ein Mensch in einer Ecke und ist traurig. Es ist immer schlechtes Wetter, sie sind immer alleine, ein soziales Umfeld gibt es gar nicht. Wir haben uns überlegt, wie wir das Thema anders platzieren können und versuchen es durch unsere Umsetzung mit einer Atmosphäre aufzuladen, die Spaß macht und mit der sich Menschen identifizieren können.
Wo seht ihr euch und eure Agentur in fünf Jahren?
Nele: Wir beschäftigen uns viel mit den Themen wie gesundes, nachhaltiges Unternehmenswachstum und wie wir unsere Firma, die sowohl uns, als auch dem Gemeinwohl dient, auf die Beine stellen können. Perspektivisch wird sich unser Team vergrößern müssen, denn mit den Workshops und Trainings können wir all das nicht mehr alleine leisten.
Luisa: Wir hoffen natürlich, dass unsere Shitshow Tools in alle größeren und kleineren Firmen irgendwie Einzug gefunden haben und wir da etwas anstoßen. Denn im Idealfall kommen wir vorbei, erzählen Dinge, bringen Tools mit und stoßen damit einen Schneeball an, der sich dann in der Unternehmenskultur ausbreitet. Wir hoffen natürlich, dass all die Sachen, die wir jetzt schon machen auch auf großer Ebene angenommen werden. Aktuell arbeiten wir auch an unserem zweiten Projekt Shitshow School.

Foto: Alena Schmick / @alena_schmick
Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
Luisa: Als wir zur Schule gingen, haben wir es alle vermisst, dass psychische Gesundheit dort nie thematisiert wurde. Über Mobbing zu sprechen, war das höchste der Gefühle. Mit 16 hatte ich dann ein Erlebnis, in der mir eine Freundin erzählte, dass sie stark depressiv sei — in mir waren hundert Fragezeichen und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte, und war komplett überfordert. Auch heute ist psychische Gesundheit noch nicht in den Lehrplänen festgeschrieben, das möchten wir verändern. Zum Glück gibt es auch noch andere Leute, die etwas verändern möchten. Im bayerischen Landtag haben zum Beispiel einige Schüler*innen eine Petition eingereicht, die fordert, Angst und Depressionen auf den Lehrplan zu setzen.
Aber da sieht man auch, dass die Schüler*innen das erst fordern müssen… . Deshalb haben wir verschiedene Formate entwickelt, wie etwa Lehrerfortbildungen, aber auch Workshops für Schüler*innen, die informieren und sensibilisieren und Scheißgefühle durch unsere Mood Suits sozusagen berührbar machen. Gemeinsam mit Schulpsycholog*innen haben wir außerdem ein paar Mini-Publikationen, wie etwa einen Lehrerfahrplan, entwickelt.
Und inwiefern unterscheidet sich die Arbeit in Schulen von der in Unternehmen?
Nele: Ich habe es so erlebt, dass Schüler*innen am meisten fordern. Bei ihnen war die Tür für dieses Thema sofort offen. In solchen Momenten merkt man auch, dass es bereits von Schüler zu Lehrer, also durch diesen Generationenwechsel, völlig unterschiedlich ist. Eigentlich ist psychische Gesundheit ein Thema der Millennials und der Generation Z, das jetzt auf die allgemeine Agenda rutscht. Viele ältere Generationen, die oft auch in den oberen Etagen sitzen, gehen viel verhaltener mit dem Thema um.
Luisa: Genau. Diese Kultur war in der Generation über uns nicht da. Sie sind damit aufgewachsen, dass Emotionen und Gefühle etwas Privates sind und das eigene Haus nicht verlassen. Deshalb ist es für viele ältere Generationen schwierig, dass darüber jetzt so offen gesprochen wird. Es kollidiert total mit ihren Grundannahmen. Es ist ja auch schön, dass jetzt Dinge von unten, also von den jüngeren Generationen, angestoßen werden.
Vielen Dank für das Gespräch!
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an