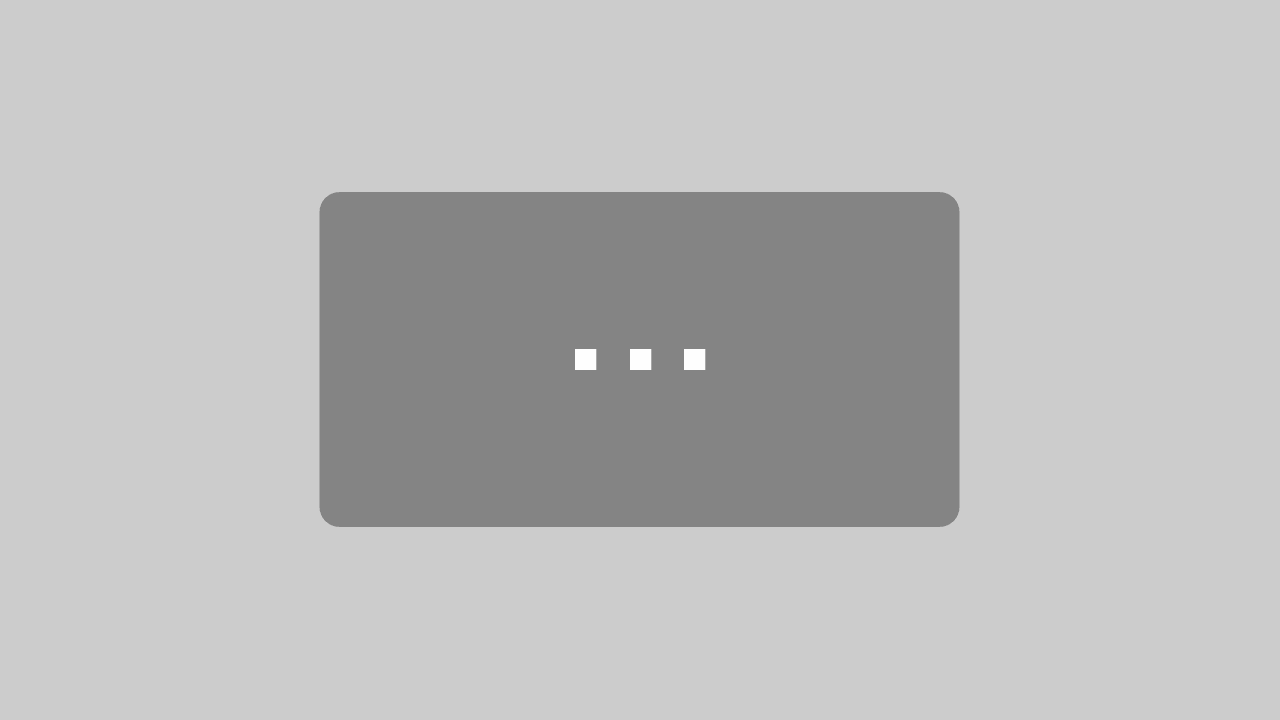Was denn noch?, denkt sich der woke Internet User und verschränkt wütend die Arme vor der Brust. Blackfacing? Klar, dass hat man schon einmal gehört, ist irgendwie bekannt und im besten Falle abgespeichert. Aber genau das passiert in digitalisierter Form? Japs, und genau das hat sich eingeschlichen in unserem digitalem Gehabe – und das nicht erst seit Kurzem. Wer erinnert sich an den berühmten 2016 Bob-Marley-Filter von Snapchat? Ha! Und es geht noch subtiler, noch versteckter und zwar so, dass man es kaum entlarven kann, wenn mal wieder ein Fall von digital Blackfacing vorliegt.
Hauptbestandteil und Problematik zu gleich? Anonyme Sphären im World Wide Web sowie eine anders codierte Sprache. Was genau hat es mit dem Digital Blackface auf sich und ab wann lohnt sich ein kritisches Hinterfragen der eigenen Internet Gepflogenheiten?
Was heute bei Sternsingern und Karnevalist*innen hoch im Kurs steht, entstammt einem gängigen US-amerikanischen Theaterhabitus aus dem 19. Jahrhundert. In damals als Minstrel bekannten Kabarett-Aufführungen schminkten sich weiße Menschen dunkel, mimten Sklaven und Hausangestellte und gaben rassistische Stereotype zum Besten, indem sie die dargestellten Figuren stets dumm und unbedarft, aber fröhlich und zufrieden in ihrem einfachen und arbeitsreichen Leben zeigten. Im Theaterkontext erschaffen, lebt diese Form von rassistischer Stereotypisierung auf den Bühnen des 21. Jahrhunderts weiter. Wir erleben Blackfacing nicht nur in deutschen Theatern („Ich bin nicht Rappaport, 2012); auch im öffentlich Rechtlichen und aktuellen Dokumentationsformaten taucht Blackface auf (Günter Wallraff, „Schwarz auf Weiß“),
sodass von einer hinreichenden Sensibilisierung noch nicht die Rede sein kann. Allem obliegt die Tatsache, dass Ethhnizität nie ein Kostüm sein darf, ist es noch so wohlwollend gemeint. Wir reden hier über das An- und Ausziehen von mit Rassismus belegten Äußerlichkeiten und das Herabwürdigen tatsächlicher Rassimuserfahrungen – nur so zum Spaß.
Fangen wir im Kontext Digital Blackface an zu hinterfragen, was für positive und negative Konotationen Schwarze Menschen in unserem multimedialen Alltag ausgesetzt sind. Nehmen wir Urbanität und vermeintliche Internationalität. Stärke und Energie, gerade im feministischen Kontexten, zudem Emporerment und Sisterhood. Wir haben Gangster Images a lá Grand Theft Auto und Stereotype wie den „Funny Black Guy“ und den Quotenschwarzen. Das war aber noch nicht alles. Was bedeutet es nun, wenn sich weiße Menschen schwarzen Memes und GIFS bedienen? Ein Thema, was erst mal in Ordnung klingt, in unserer Internetsprache von Social Media bis Zeit Newsletter aber permanent stattfindet und reproduziert wird. Genutzt wird die Anonymität des Internets, um stereotypisch „Schwarzes Verhalten“ zu verkörpern. Das Embodyment im Kontext des Stereotyps der „Angry Black Woman“ zum Beispiel, um in einem Twitter Thread zu zeigen, etwas nicht mit sich machen zu lassen. Betroffen sind natürlich auch WhatsApp Chats und auch die Verwendung von gewissen GIFS in Instagram Storys macht davor nicht halt.
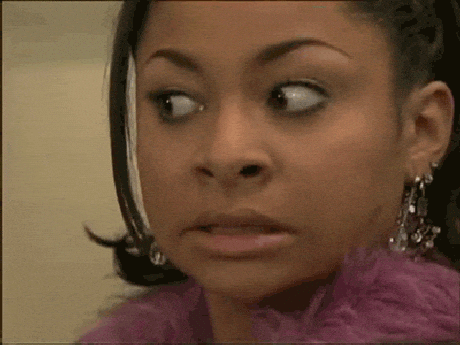
Heute können wir nach der Huffington Post drei Arten von Digital Blackface unterscheiden.
Zum einen die Aneignung „schwarzer Features“ in Selfie Anwendungen, wie dem 4/20 Bob Marley Snapchat Filter, der Usern eine dunklere Haut, breitere Nasenflügel und Dreadlocks verlieh. Dazu kommen außerdem gängige „Face-Swap“ Anwendungen, in denen Nutzer*innen die Gesichter von beliebten A Promis auf ihr eigenes schneidern können, somit leicht die Gesichtszüge und Hautfarbe von Jay-Z bis Nicki Minage verpasst bekommen.
Zweitens sind es Twitter „Mocking-Accounts“: Weiße Menschen nutzen hierbei Schwarze, ausgedachte oder reale Identitäten und verwenden hierbei eine stereotypisierte, als Schwarz empfundene Ausdrucksweise. Durch vergleichbare Profile werden regelmäßig Schwarze Initiativen oder Gruppierungen in sozialen Netzwerken gemockt.
Übrig bleibt die Praxis des digital Blackfacing durch die Nutzung gewisser Memes, in welchen Schwarze Menschen als Protagonist*innen im Mittelpunkt stehen. Problematisch ist hierbei vor allem, dass die Macher*innen Stereotype, Schwarze Ausdrucksweisen und Attitüden nutzen, um Lacher zu generieren, somit Schwarze Stereotypen reproduzieren und das Internet-Ich für das Gegenüber auf einmal die Schwarze Frau mit dem erhobenen Zeigefinger ist. Wichtig ist hier natürlich wieder zwischen „Selbst- und Fremdbezeichnung“ zu unterscheiden, sprich: Klar herauszuarbeiten, warum es etwas anderes ist, wenn ich besagte Memes benutze oder mein weißer Freund es tut.

Eine Sensibilisierung und ein rassismuskritischer Blick sind nicht nur wichtig, um eigenes und fremdes Fehlverhalten zu entlarven, sie schützen auch unsere Mitmenschen vor rassistischen Denkweisen und stereotypischen Weltanschauungen. Vor allem für Menschen, die sich viel in digitalen Räumen bewegen, ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Nutzung- und Rezeptionsverhalten wichtig. Memes, Apps & Co. sind transmediale Trends, die sich von Instagram in unser Jetzt schleichen, die auf Twitter entstehen, aber Bestandteil echter Konversationen werden und unsere Wirklichkeit bestimmen. Warum benutze ich das Meme? Warum ist es lustig? Auf welchem Mythos, Habitus oder Fun Fact baut es auf? Das Ergebnis: Das, was eigentlich als banaler Spaß erscheinen sollte, ist plötzlich so viel mehr als das.
Das Wahnsinnige an rassistischen Strukturen? Hat man sie einmal geknackt und als solche identifiziert, laufen sie uns überall über den Weg laufen. Ähnlich wie uns täglicher Sexismus bei Frauen begegnet. Aber das ist nur der Anfang, denn es gibt kaum noch Situationen, kaum Literatur , keine Werbung noch Nachrichten, in denen uns die genannten Ismen nicht begegnen. Und dann lohnt es sich, noch einmal extra darauf zu achten, eine extra Gedankenrunde zu drehen, bevor wir platt reproduzieren, drüber lachen und mitmachen. Puh, ganz schön spaßbefreit und mühselig, oder? Aber lasst euch eines sagen: Den Betroffenen kostet der Diskurs am Ende immer noch am meisten Kraft.