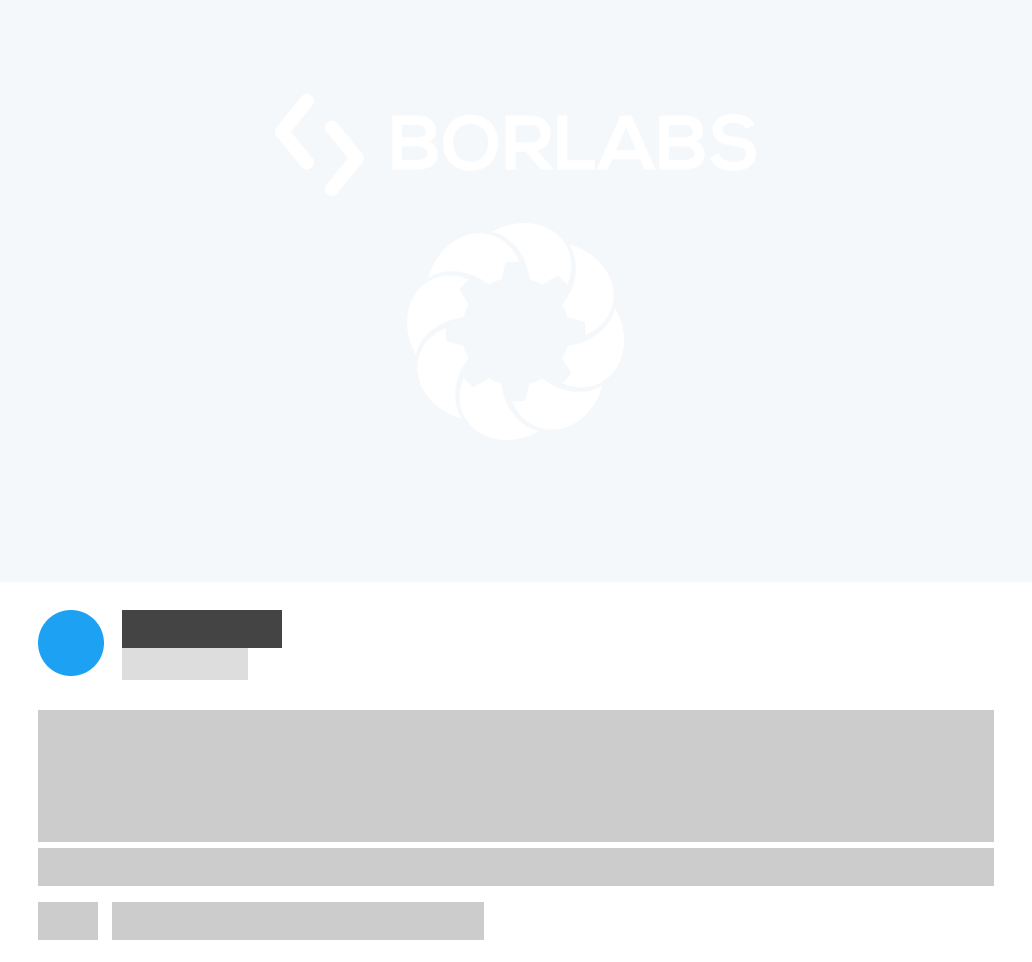Mit ihrem Buch „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen: aber wissen sollten“ hat sich Alice Hasters in einen Club beeindruckender Frauen eingeschrieben, der die Spate antirassistische deutsche Literatur erfolgreich geprägt hat. Die gebürtige Kölnerin, vielen vielleicht bereits bekannt durch ihre journalistische Arbeit oder durch den Podcast Feuer & Brot, den sie zusammen mit Maximiliane Häcke betreibt, berichtet beeindruckend sachlich und ruhig über persönliche rassistische Alltagserlebnisse und verbindet sie gekonnt mit historischen Eckdaten, erweiternden Beispielen und ab und an sogar feinsten trockenen Anekdoten.
Aber: Rassismus und Humor – geht das denn überhaupt zusammen? Aber ja! Bei persönlichen Coping Mechanismen, zum Beispiel, ist es oftmals die einzige Strategie, sich mit bestimmten Situationen in der Retrospektive noch auseinandersetzen zu können. Aber zurück zum Buch: Denn genau das ist in Rubriken und Kapitel unterteilt, die aufzeigen, wie vielschichtig und komplex Rassismus BIPOC begegnen kann. Alice besonnene und ruhige Worte über Heimat und Zugehörigkeit, Schwarze Geschichte und alltägliche Bürden haben mich nicht selten so sehr berührt, ohne mich verzweifeln zu lassen. Auch wenn es sich hier nicht um leichte Kost handelt, ist es ihr gelungen, eine dem Geschriebenem durchaus optimistische Dynamik zu verleihen.
Ich habe Alice für Jane Wayne nun ein paar Fragen zu ihrem ersten Buch gestellt und mit ihr über wütende weiße, toxische Stereotype und die „Babylon Bastards“ geredet.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Liebe Alice, wem würdest du raten, dieses Buch zu lesen?
Das Buch ist in allererster Linie für Menschen gedacht, die sich mehr mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen wollen. Es ist vor allem für weiße Menschen gedacht, die sich selbst als nicht-rassistisch einschätzen und dennoch die aktuelle politische Lage nur schwer nachvollziehen können und noch immer von „währet den Anfängen“ sprechen. Ich möchte diejenigen erreichen, bei denen ich noch Hoffnung habe, dass Diskurs und Aufklärung helfen können. Es muss die Motivation gegeben sein, rassismuskritisch denken lernen zu wollen. Und natürlich ist es aber auch für von Rassismus betroffene Menschen gedacht, die unsicher sind, wie sie gewissen Sachen gegenüberstehen sollen. Auch für solche, die sich zeitweise alleine mit ihren Geschichten, Erfahrungen und Verletzungen fühlen.
Glaubst du, dass der Titel Menschen abschrecken könnte?
Mit dem Titel ist es so eine Sache. Tatsächlich hatte ich vorher etwas anderes im Kopf, was eher in Richtung Wortspiel ging oder impliziter war. Ich bin mir sicher, dass es gewisse Menschen abschreckt, frage mich aber ohnehin, mit welchem Titel man Leute, die vergleichbare Literatur dringend lesen müssten, an Board bekommen könnte. Es ist eine Falle, wenn man weiße Menschen in vergleichbaren Kontexten in einer höflichen „Bittstellung“ adressiert, um ihnen immer wieder rückzuversichern, dass man weiß, dass sie keine schlechten Menschen sind. Das wiederum ist auch Teil des Problems: Im gesamten Buch halte ich meinen Tonfall für klar, aber ziemlich freundlich und nicht harsch, auch wenn ich hier schon andere Meinungen gehört habe. Ein expliziter Titel ist für dieses Buch auf jeden Fall richtig und wichtig. Exit Racism von Tupoka Ogette, zum Beispiel, ist ein viel didaktischeres Buch, was Menschen anders an die Hand nimmt. Ich für meinen Teil bin aber auch für eine Diversifikation des Rassismusdiskurses. Für manche Menschen ist mein Buch vielleicht noch immer zu hart, schroff oder polemisch, anderen wiederum zu soft und zu wenig wütend: ich hab versucht, so gut es geht meine Wahrheit aufzuschreiben.

Foto: H. Henkensiefken
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Du thematisierst Stereotype Bilder und Vorurteile. Müssen wir gemeinsam an neuen Narrativen der Herkunftsländer nicht-weißer Menschen arbeiten?
Wir sollten es vielmehr den Menschen, die aus diesen Herkunftsländern kommen, überlassen, ihre eigenen Narrative zu formen und in diesem Zuge auch die Geschichtsschreibung übergeben. Das Problem ist, dass weiße Menschen die Narrative kontrollieren und stets etwas projiziert wird. Was wir brauchen, ist eine Fokusverschiebung. Lasst BIPOC zu Wort kommen und ihr deutsch sein definieren. Lasst uns selbst Raum für Diskussionen suchen und lasst uns Zeit, das alles zu verhandeln. Man gerät so schnell unter Druck, eine Lösung parat zu haben. Es wird so häufig eine ausformulierte Strategie ausgehend von BIPOC erwartet. Gebt uns ein bisschen Zeit. Verschiedene Menschen haben verschiedene Wahrnehmungen, verschiedene Lösungen und Ergebnisse. Fokusverschiebung auf diejenigen, die wirklich etwas zum Diskurs zu sagen haben.
Warum fällt es weißen Menschen so schwer, antirassistisches Engagement als Notwendigkeit in Zeiten von rechtem Terror anzusehen?
Man darf nicht übersehen, dass es viele Menschen gibt, die sich antirassistisch engagieren. Oft bleibt bei großen Gesten, die zwar sehr wichtig sind, aber der Sprit im Alltag verloren. Außerdem ist dieser Aktivismus reaktionär: Erst passiert ein Anschlag, dann gehen die Menschen auf die Straße, weil sie schockiert sind, dass so etwas passieren kann. Aus Entrüstung und Schock. Zumindest wird vor allem in der Politik immer wieder von „Alarmzeichen“ gesprochen. „Wehret den Anfängen“ eben. Welche Zeichen? Welche Anfänge? Es ist schon Alarm und wir sind schon längst über die Anfänge hinaus. Man muss den Begriff von Engagement weiter fassen. Nicht nur als etwas, was sonntags auf Demos stattfindet.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ich habe die Spiegel Online Kommentare zu deinem Interview mit Stefanie Witterauf gelesen. Wieso werden so viele so wütend und verständnislos, wenn es um die Diskussion um Rassismus und Hautfarben geht?
Ich glaube, weiße Menschen hätten das Thema gerne vom Tisch. Sie wollen die Privilegien, sprich Wohlstand, Maßstab, Neutralität und Zentralität, möchten aber gleichzeitig Rassismus als Thema ausklammern. Jedes Mal, wenn Rassismus dann zum Thema wird, kann man diese Privilegien aber nicht thematisch ausschließen. Es ist also nicht möglich, beides getrennt voneinander zu diskutieren. Ich habe auch oft das Gefühl, dass weiße Menschen frustriert sind, weil sie vermeintlich schon so viel machen. So nach dem Motto „Ich versuche doch schon ein guter Mensch zu sein“ – und das klingt wie eine Verweigerung noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Indem man sie als Identität benennt, so wie andere Menschen schon seit jeher nach Identitäten kategorisiert werden und man die eigene Perspektive einsetzt, in der BIPOC stets betitelt werden, finden viele das unglaublich unangenehm. Es geht hier aber auch um das historisch gewachsene Phänomen, Rassismus hier in Deutschland mit dem Holocaust zu verbinden. Fast wie ein zu wenig aufgearbeitetes Trauma. Deshalb können Menschen noch immer nur schwer darüber sprechen und tun lieber so, als würde es nicht existieren.
Oft gerät man mit weißen Menschen in schwierige Diskussionen, wenn es um Sagbarkeit oder problematische Sprache geht. Lohnt es sich noch diese Diskussionen zu führen?
Marginalisierung äußert sich oft durch Sprache. Ich bin der Meinung, dass BIPOC sich die Freiheit nehmen können, auszuwählen, mit entsprechenden Personen zu diskutieren oder nicht. Schließlich muss man eigene Gefühle und Verletzbarkeit abwägen, teilweise beiseiteschieben, um in die Diskussion zu gehen. Das ist oft sehr anstrengend. Ich habe erlebt, wie Diskussionen etwas gebracht haben. Und ich habe gesehen, wie Diskussionen überhaupt nichts gebracht hab. Eine generelle Regel kann ich also nicht aufstellen. Ich glaube aber, und das ist wichtig, dass man nicht mit allen Menschen diskutieren muss. Es gibt einen großen Teil in dieser Gesellschaft, der aus Mangel an Auseinandersetzung mit dem Thema eine bestimmte Haltung hat, der dennoch aufgeklärt werden kann. Es gibt auch Menschen, die sich aktiv dagegen stellen. Ich meine damit Rassist*innen, Rechtspopulist*innen und Nazis. Mit denen muss man nicht reden. Man muss auch nicht versuchen sie aufzuklären. Ich bin sicher, dass sie alle notwendigen Informationen haben, um nicht so eine Haltung einnehmen zu müssen. Und es macht sie leider fast ein bisschen unschuldiger, als sie sind. Genau das macht einen oft mürbe.
Du schreibst über den Stereotype Threat. Kannst du konkret sagen, inwieweit dieses Konstrukt auch Einfluss auf dein Leben genommen hat?
Stereotype Threat beschreibt die Angst, mit dem eigenen Verhalten einem bestimmten Stereotypen zu entsprechend. Wenn man als Schwarze Frau laut lacht, zum Beispiel, oder offensichtlich wütend oder aufbrausend ist, bedient man einen bestehenden Stereotypen. BIPOC haben nicht den Luxus als Individuum wahrgenommen zu werden, sondern nur als Vertreter*innen einer bestimmten Kategorie. Ich habe schon das Gefühl, mir oft Druck gemacht zu haben. Beispielsweise immer Angst zu haben, nicht schlau genug zu sein. Es sind bei mir gewisse Minderwertigkeitskomplexe, die sich eingeschlichen haben. Gerade wenn ich in einem Raum bin, in dem viele nicht von Rassismus betroffene Menschen anwesend sind, insbesondere wenn keine Schwarzen Menschen da sind, tendiere ich dazu, einen gewissen Habitus anzunehmen, der sich gewissen Stereotypen entgegenstellt. Extra ruhig sein. Besonders nett sein. Besonders geduldig. Ich versuche, das abzulegen, müsste aber lügen, wenn ich behaupten würde, mich vollkommen davon befreit zu haben.
Dein Buch liest sich klar und verständlich. Eines aber fällt auf: Du bist ganz ruhig und besonnen in deiner Art und Weise zu schreiben. Ist das bei so einem Themengebiet nicht unheimlich schwierig?
Ich habe den Vorteil, ein ruhiges Gemüt zu haben, was bei dem Schreiben eines solchen Buches sehr viel bringt. Ich hatte außerdem den Luxus, Sicherheit in diesem Bereich zu genießen, da schon Menschen vor mir diesen Weg gegangen sind. Tupoka Ogette, Noah Sow, May Ayim, Katharina Oguntoye, Dagmar Schulz, aber auch viele Menschen im nicht deutschsprachiger Raum. Aber klar war es schwierig, um auf deine Frage zurückzukommen. Durch gewisse Kapitel habe ich mich sehr gekämpft, weil schlichtweg gewisse Emotionen hochgekommen sind. Auch wenn die Sachlage total klar ist, war es im Schreibprozess immer wieder anstrengend zu versuchen, Emotionen so aufzuschreiben und zu bündeln, dass die Botschaft am Ende rüberkommt und das Vermitteln im Fokus steht. In dem Buch steckt viel emotionale Arbeit.
Diese Passage hat mich sehr berührt. Deine Mutter ist Amerikanerin, du und deine Schwestern sind in Deutschland aufgewachsen. Wie gehst du heute damit um, in Deutschland als „nicht zugehörig“ identifiziert zu werden?
Das Gefühl, nicht zugehörig zu sein, löst noch immer einen gewissen Schmerz in mir aus und ist etwas, das mich traurig macht. Ich versuche, mir die Frage zu stellen: „Wie sieht ein Leben aus, bei dem es keine eindeutige Zugehörigkeit gibt und wie geht man damit um?“ Gerade als Schwarze Deutsche und Afroamerikanerin ist es ein kollektives Trauma. Ich empfinde Zugehörigkeit als etwas lokaleres und gleichzeitig Überregionales. Es gibt beides. Ich merke, dass mir spezifisches „deutsch sein“ nicht so wichtig ist, sodass ich die Zugehörigkeit in der Afrodiaspora finde – oder eben in Köln. Entweder also im sehr Kleinen oder im sehr Großen. Ich denke, es ist ohnehin schwierig, weil der Diskurs um nationale Identität in Deutschland ja schon lange geführt wird, weil er Menschen immer ausschließt. Ist nationale Zugehörigkeit überhaupt eine gute Sache? Der Versuch, das nicht zu priorisieren, schlägt gerade zurück, weil jetzt Menschen sehr laut werden, die eine deutsche Zugehörigkeit im nationalistischen Sinne fordern und das so tun, dass BIPOC ausgeschlossen und schlichtweg nicht gemeint sind.
Natürlich bin ich auch an deiner Jugend-Clique – den „Babylon Bastards“ hängengeblieben. Warum ist Identifikation für junge BIPOC etwas anderes als für weiße Jugendliche?
Es war schön, noch einmal an diese Clique mit diesem peinlichen Namen zu denken. Ich sehe es als großes Glück an, überhaupt eine Bezugsgröße zu finden, mit der ich mich auf multiplen Ebenen identifizieren konnte. Die Antwort dieser Frage liegt auch in meiner Antwort auf die davor. Wenn man merkt, man wird bei einem kollektiven Zugehörigkeitsgefühl nach dem alle suchen ausgeschlossen, wenn man zum Beispiel immer von „denen“ und einem „wir“ spricht und man auf der Seite „der anderen“ ist, ist es unglaublich wichtig sich Räume zu schaffen – gerade in der Jugend, in der Zugehörigkeit so ein großes Bedürfnis ist. Wir brauchen einen Raum für Empowerment, einen ohne das ständige Gefühl, ein Defizit zu haben, nur weil man nicht weiß ist. Ich bin wahnsinnig dankbar für die Babylon Bastards.
Danke dir, Liebe Alice!
„Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen: aber wissen sollten“, ist am am 23.September bei Hanserblau erschienen. Ausstehende Auftritte, Lesungen und Live-Termine von Alice gibt es außerdem hier. |