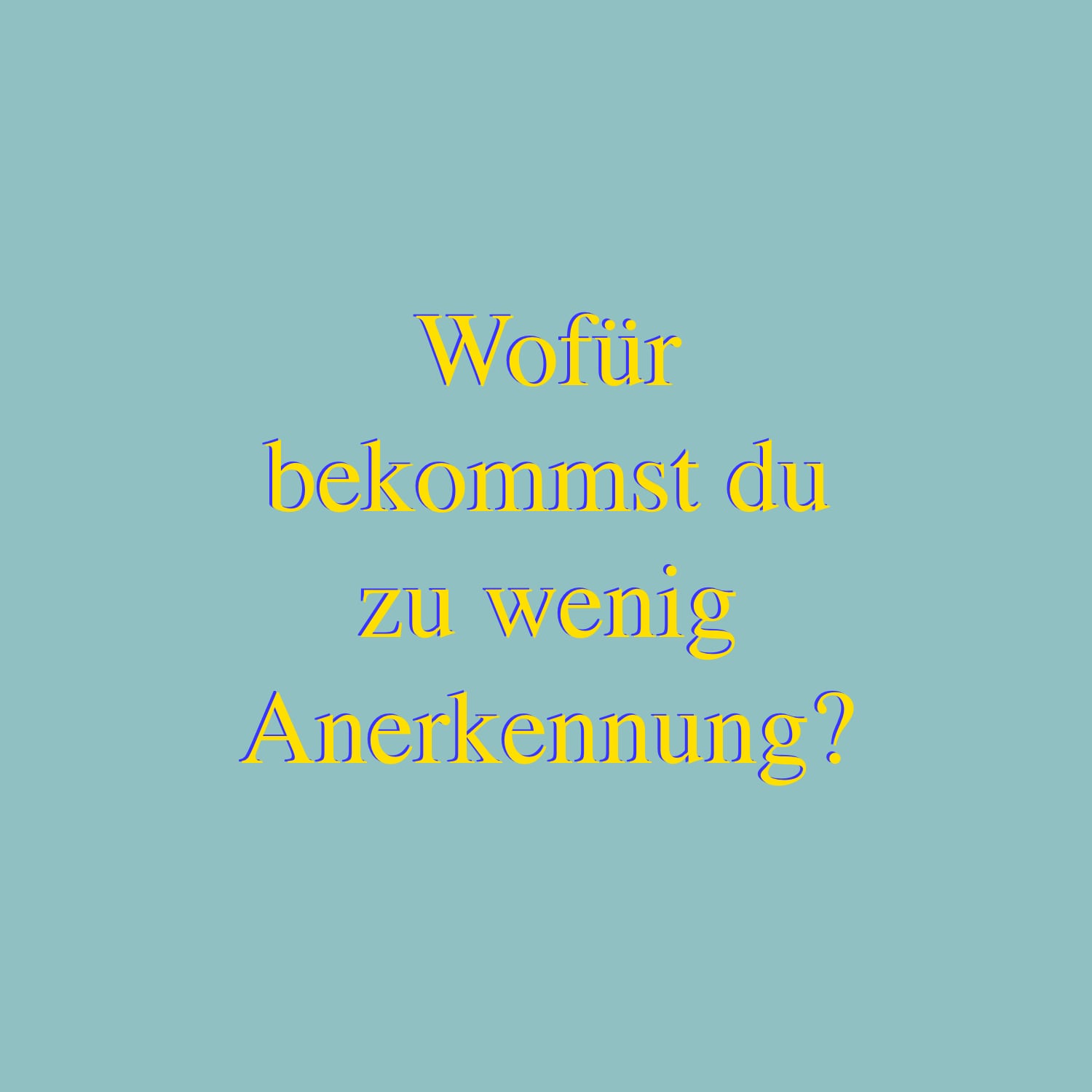„Man kann sehr glücklich sein, wenn man die Zustimmung der anderen nicht fordert“ soll Goethe einmal gesagt haben. Klingt plausibel. Aber so ist das ja oft: Die Ratio ist gegen das Gros der Gefühle mitunter machtlos. Statt also frei und unabhängig von den Beurteilungen anderer durch die Welt zu wanken, suhlen sich nicht wenige von uns in der durch die Tricks der Social Media Blase womöglich noch moderner gewordenen Sucht nach Anerkennung. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Sondern um das Grundbedürfnis, gesehen zu werden – das wiederum erstaunlich wenig mit Lob zu tun hat, wenn man mich fragt. Lob ist meist zeitlich begrenzt, es bezieht sich auf ein explizites Handeln. Lob ist nicht verkehrt, aber es kann, wenn man genau hinsieht, Ausdruck eines (temporären) Machtgefälles werden. „Das hast du gut gemacht“, heißt eben auch: Ich beurteile dich. Es kann bedeuten: Du hättest auch verkacken können. Gesellt sich Lob nun aber zur aufrichtigen Wertschätzung, kommt am Ende etwas Wunderbares dabei heraus. Die Aussage „Ich finde es toll, dass du dich getraut hast, ich bin stolz auf dich“ spricht etwa eine andere Sprache. Sie lässt Fehler zu. Sie bezieht sich nicht auf das Ergebnis. Sie gilt auch im Falle des Scheiterns. Meine Güte, und Scheitern, das tun wir ja alle, zum Beispiel im Alltag.
Wie wenig wir in diesem Alltag aufrichtig anerkennen, was Kollge*innen, Eltern, Freunde, ja sämtliche Menschen um uns herum leisten, wie viel sie schaffen und stämmen, wurde mir erst bewusst, als ich dieser Tage der aktuellen und rundum hörenswerten Folge des „Rolemodels“-Podcasts mit Hadnet Tesfai lauschte. Darin erzählt Host David gleich zu Beginn von einem Abend mit Bekannten, der erst durch eine bewusst angestoßene Fragerunde zu einem echten Miteinander wurde. Wir kennen sie doch, diese bequeme Grüppchenbildung an großen Tischen, die in Wahrheit ein Fluch ist. Wie oft haben wir schließlich Zugriff auf so viele, bunte Perspektiven, Erfahrungen und Meinungen? Eine Frage muss jedenfalls besonders intensiv gefruchtet haben. Sie lautete: Wofür bekommst du zu wenig Anerkennnung?
Wie ein dicker Elefant saß sie schließlich auch mitten in meiner Küche. Diese Frage, meine ich, diese Offenbarung, dieser Spiegel – da war ich gerade dabei, gleichzeitig einen Pfannkuchen vor dem Verkokeln zu retten und mit einer Kundin zu telefonieren, in der einen Hand das Telefon, in der anderen nur eine Gabel, weil die kaputte Spülmaschine schon seit Tagen den Pfannenheber verschluckt hatte, als das Badewannen-nasse Kind sich plötzlich mit einem lauten Platscher auf sämtliche auf dem letzten Papier ausgedruckten Unterlagen setzte, die ich fahrlässig auf der Eckbank abgelegt hatte, wegen der fehlenden Hände und der wenigen Zeit aber auch ein bisschen, um zu vergessen, dass dieser Panel Talk ansteht, vor dem ich mich fürchte, weil ich mich nunmal vor jedem Panel Talk fürchte. Daraufhin flüsterte ich mir letztendlich eine selbstbewusste, kleine Motivationsrede ins Ohr, sagte „Mensch Nike, Respekt. Für du weißt schon was.“ Aber dann, dann wurde ich sauer. Auch auf mich selbst. Wann habe ich so etwas zuletzt eigentlich jemand anderem gesagt? Na klar, ungefähr gestern. Aber habe ich da nicht jemanden vergessen? Oder gar alle, von denen ich ohnehin per se erwarte, dass sie welches Ding auch immer schon irgendwie schaukeln werden? Bin mir nicht sicher. Bekomme ich denn selbst genug Anerkennung? Und wenn nicht, wie fordert man sie überhaupt ein? Gar nicht? Selbst Schuld? Was denn jetzt?
Ich fragte mich das wirklich. Wieso die Leute sich so schnell an die Leistungen, an die Balanceakte und Lebens-Spagate anderer gewöhnen, wieso wir aufhören, vehement Support zu zeigen, wenn eine*r scheinbar sowieso alles irgendwie hinbekommt, wieso wir dazu neigen, mit Wertschätzung zu geizen, für das reine Existieren, aber auch für all die kleinen und großen Leistungen, für das Alltägliche, sobald jemand nicht laut genug nach Aufmerksamkeit schreit. Ist das nicht fatal? Jeden Tag tun wir alle doch dies und machen das, wir strengen uns an und sind erschöpft, wir rennen ohne anzukommen, sind aus der Puste. Und viele von uns hören dann noch nicht einmal: Ein klitzekleines liebes Wort, das zeigt „Ich sehe dich“. Dabei ist es gar nicht schwer. Weil doch eigentlich fast alles besser ist als Schweigen. Einfach machen zum Beispiel:
Wir könnten Menschen, die uns wachsen lassen, die uns bilden und begleiten, hin und wieder sagen: „Ich lerne von dir.“ Weil das zeigt: „Deine Arbeit ist nicht selbstverständlich“.
Wir könnten beim nächsten Mal die Spülmaschine ausräumen, wenn wir bei einer befreundeten Mama zu Besuch sind. Weil das zeigt: „Ich weiß, was du jeden Tag schaffst“.
Wir könnten andere mehr nach Rat fragen, weil das zeigt: „Ich schätze dich“.
Wir könnten unseren Freunden viel häufiger schreiben: „Ich denke an dich.“ Einfach so.
Wir könnten unserer Verabredung mal wieder ein altes Buch mitbringen, als Liebeserklärung an das Gehirn des Gegenübers.
Wir könnten unseren Kolleg*innen morgen ein High Five geben. Für ihr wisst schon selber was.
Wir könnten unseren eigenen Eltern sagen, dass sie krass sind. Weil wir jetzt schon so groß sind. Und ich bin mir sicher, da gibt es noch mehr.
Und jetzt ihr – wofür gebt oder bekommt ihr
|