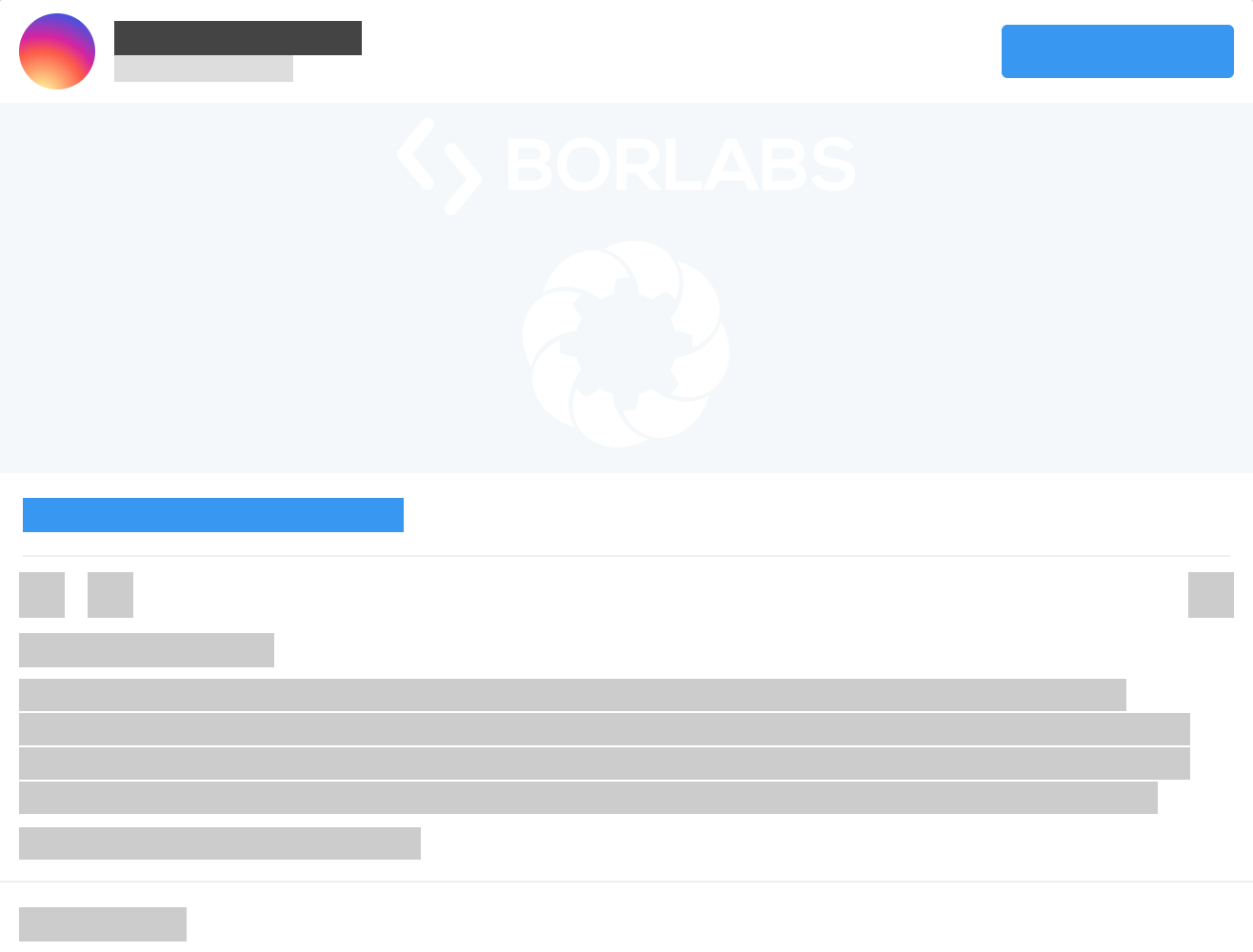Heute ist der 17. März und es scheint nichts absurder, als dass wir uns vor wenigen Tagen noch unbekümmert über anstehende Urlaube in der zweiten Jahreshälfte unterhalten haben. Der Terroranschlag von Hanau ist 25 Tage her. Silvester 88 Tage. Vielen ist eine normale Routine ihres Tagesablaufes nicht mehr möglich. Ihre Kinder müssen zuhause bleiben. Ihre Jobs stehen auf der Kippe, sie sind selbst betroffen oder sorgen sich um kranke Angehörige. Vor nicht langer Zeit, an Tagen, an denen man noch daran geglaubt hat, die Zukunft planen zu können und sich Termine einzutragen, da haben viele von uns noch in einer anderen Sache gekämpft. Sie waren zum Frauenkampftag am 8. März auf den Straßen, engagierten sich für den Black History Month im Februar oder diskutierten über den Berliner Mietendeckel. Vor nicht all zu langer Zeit, und auch heute noch, stand der Wunsch nach dem Ausnahmezustand für die eigene Sache im Raum. Was ist aus ihm geworden?
Die eigene Sache, das sind die Kämpfe des Inneren und des engsten Umfelds, für die wir uns zuweilen mehr Aufmerksamkeit gewünscht haben, mehr Solidarität der anderen und auch Momente, in denen nicht nur man selbst zum Kampf bereit ist. Frustriert durch Reaktanz, Zeitmangel oder Ignoranz unserer Mitmenschen waren wir bis auf entsprechenden politischen Gruppierungen oft alleine mit den Sorgen und Forderungen. Ein bisschen neidisch haben wir dann zu den Ikonen unserer Zeit geblickt. Luisa Neubauer, Greta Thunberg oder Vanessa Nakete. Die Aufmerksamkeit und Publicity, die Relevanz und die Stringenz ihres Kampfes. Heute steht gefühlt alles still. Nicht weil alle Kämpfer*innen ihr Zepter niedergelegt haben. Vielleicht eher, weil es absurd erscheint, die Gedanken dieser Tage abweichen zu lassen von einer ungewissen Zukunft, einem ungewissen Europa und einem ungewissen Deutschland. Ich habe meinen eigenen Kampf vergessen. Es fühlt sich leer und hilflos an, in Zeichen wie diesen für Dinge abseits von Krankheit und Genesung um Solidarität zu bitten.
Was war das noch einmal mit der Solidarität? Wenn sich Menschen nicht gerade Dinge des alltäglichen Lebens aus den Händen reißen, käme einem die Stimmung in örtlichen Supermärkten und Drogerien beinahe gemeinschaftlich vor. „Alles Gute“ und „Pass auf dich auf“, wird sich an der Kasse gewünscht. Aus der Not heraus gibt es kein Geschubse mehr auf Rolltreppen oder rüde Gästen, wenn jemand ausweichend in den anderen hineinstolpert. Wer es ernst meint und es sich erlauben kann, verlässt das Haus nur zum Isolationsspaziergang. Was wir auf den Straßen sehen können, in Foren oder Tweets lesen, ist eine Mischung aus stiller Furcht, Irritation und mangelnder Zukunftsorientierung. Ein Leben im Jetzt, weil wir müssen und die Gewissheit, dass viele im selben Boot sitzen. Dass etwas passiert, was fast jeder versteht und vor dem so viele ähnliche, berechtigte Angst haben und einige sogar existenzielle Sorge verbindet. Endlich.
Gemeinsam wird darauf gewartet, dass die dort oben eine drastische Entscheidung reffen, weil Individuen der eigenen Intuition oder dem Drang dann doch das Haus zu verlassen, nicht mehr vertrauen. Wie soll auch jemand, der zwischen Optimismus, gleißender Panik und entschleunigtem Hausarrest wechselt, noch einen klaren Kopf darüber bewahren, was es als Nächstes zu tun, zu lassen, zu arrangieren oder unterstützen gibt?
Es ist nicht leicht, sich in Zeiten der allgemeinen Irritation anderen Themen zu widmen, als dem einen. Vergesst aber die alten Kämpfe nicht, die alten Triumphe und Niederschläge. Denn sie werden es uns nicht verzeihen, wenn wir sie auf unbestimmte Zeit aus unseren Köpfen verbannt haben, verdammt dazu zu stagnieren. Wir wissen ja alle, dass es irgendwann weitergehen muss.