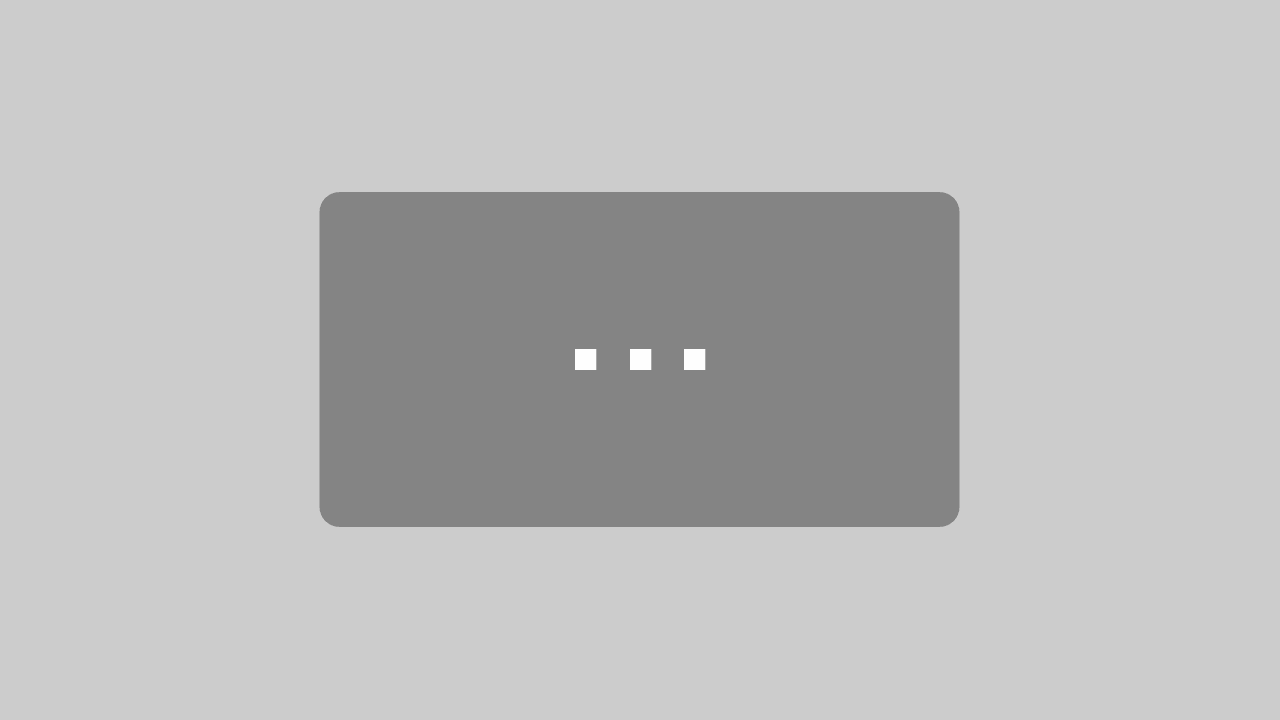Neulich, da erinnerte ich mich an einen Spieleabend mit einer Freundin, die zwar eine wundervolle, liebenswürdige Person, aber eben auch eine furchtbar schlechte Verliererin ist — zumindest wenn es um Mensch ärgere Dich nicht geht. Da fluchte sie nämlich, was das Zeug hält, während ich mich mit meinen kleinen Figürchen an ihr vorbeischlich und ihre Männchen in regelmäßigen Abständen vom Feld schmiss. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ich dabei weder schelmisch grinste, noch stichelnde Bemerkungen von mir gab. Tatsächlich nämlich hätte ich viel lieber mit ihr getauscht. Ja, ja, ich weiß, mein kleiner Wunsch dürfte jetzt für mindestens fünf Fragezeichen und ein tiefes, aus dem Bauch geatmetes „Häääää“ sorgen und ist dennoch nicht weniger wahr: Ich bin nämlich eine famose Verliererin. Das bedeutet nicht bloß, dass ich es nicht schlimm finde, zu verlieren. Nein, es geht sogar so weit, dass ich in größeren Gruppen richtig froh bin, wenn ich das Spiel als Letzte beende, während mein entschuldigendes Lächeln und das resignierte Schulterzucken mit einer puren Erleichterung einhergehen.
Gewinne ich doch einmal, beschleichen mich kurzerhand nicht nur Schuldgefühle, auch ist es mir wahnsinnig unangenehm, alle Blicke auf mir zu spüren und den Erwartungen an eine Jubelpose gerecht zu werden. Es ist nämlich so: Freudensprünge und laute Jubelschreie zählen nicht zu meinem Repertoire, vielmehr freue ich mich meist leise, irgendwo in mir drinnen, wenn auch natürlich nicht weniger doll, als andere. Und trotzdem habe ich mich in der Vergangenheit schon häufiger dabei erwischt, mich für meine stille Freude zu entschuldigen, fast so, als wolle ich allen mitteilen, dass ich auch wirklich normal sei, mir das Jubeln bloß ein klein bisschen im Hals stecken geblieben sei vor lauter Freude. Das Schuldgefühl, den merkwürdigen Scham und den Wunsch, dass all das doch bitte möglichst schnell vorbeigehen solle, verschwieg ich dabei stets und war ein wenig froh, dass ich wenigstens diese Aspekte — anderes, als die Röte, die mir ins Gesicht geschossen war — verheimlichen konnte.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Dass ich mich mit dem Gewinnen schwertue, ist natürlich nicht einfach nur bei vermeintlichen Banalitäten wie Brettspielen der Fall. Eigentlich schleicht sich dieses seltsame Phänomen ja bereits durch sämtliche Bereiche meines Lebens. Mit 15 hatte ich so etwa einen ordentlichen Durchhänger in der Schule und erwartete in meinen schwachen Fächern (Physik und Chemie) alles andere als Glanznoten. Kurz vor der Notenausgabe steckten meine Tischnachbarinnen und ich bibbernd die Köpfe zusammen, während wir uns alle mit unseren negativen Erwartungen zu übertrumpfen versuchten. Wir waren uns sicher, eine Vier minus, ach was, mindestens eine Fünf oder vielleicht sogar eine Sechs auf dem Test stehen zu haben. Wie es so kam, war ich natürlich die Einzige von uns, deren Note nicht vorzeigbar war — und auch damit lernte ich, in den kommenden Jahren umzugehen, was oftmals dazu führte, dass ich mein eigenes Scheitern besser wegstecken konnte, als das einer Freundin. Hatte ich doch mal eine bessere Note, hätte ich für einen Moment wohl sogar unsere Arbeiten vertauscht, nur um ihr ein besseres Gefühl zu geben.
Jedenfalls habe ich es in all der Zeit erfolgreich geschafft, mich sowohl im Berufs-, als auch im Privatleben stets auf negative Kritik einzustellen, was es für mich fast unmöglich macht, ordentlich mit Lob und Komplimenten umzugehen, obwohl liebe Worte und positives Feedback natürlich auch in meinen Ohren lieblich nachklingen und meine Laune beflügeln. Die dicke Problematik, die dabei entstand, nun fies in einer Ecke hockt, mich anglotzt und die selbst ich an dieser Stelle nicht mehr übersehen kann: Ich halte mich selbst so klein wie einen Flaschendeckel, der von einer Straßenbahn plattgerollt wurde. Das kann ich sogar richtig gut, denn ich habe es nicht bloß einmal gelernt, sondern über viele Jahre trainiert, fast so, als wolle ich wenigstens in dieser Disziplin eine Goldmedaille gewinnen.
Dieses „sich selbst Kleinmachen“ habe natürlich nicht ich erfunden. Tatsächlich ist es nämlich ein weitreichendes, ausgereiftes Phänomen, das, geht es nach der amerikanischen Poetry Slamerin Lily Myers, insbesondere unter Frauen verbreitet ist. In ihrem Stück „Shrinking Women“ aus dem Jahr 2013 spricht sie etwa darüber, dass Frauen lernen, nach „innen zu wachsen“, um weniger Platz einzunehmen und möglichst nicht aufzufallen. Die Tücke: Haben wir uns erst einmal daran gewöhnt, nicht aufzufallen, bemerken wir auch den damit einhergehenden Schutzmechanismus, denn: Wenn man nur leise genug ist, bewahrt uns unserer Schweigen, unser apathisches Nicken, unser Verlieren, vor negativer Kritik — oder besser noch, vor all jenen Schubladen, in die Menschen gesteckt werden, die „zu laut“, „zu egoistisch“, „zu selbstverliebt“ sind. Sich in dieser Sicherheit zu suhlen, bedeutet schließlich auch, dass wir uns weder mit uns selbst mitsamt unseren Ecken, Kanten, Marotten und Gefühlen auseinandersetzen, noch an einer Selbstakzeptanz arbeiten müssen.
„Stop shrinking yourself to fit places you’ve outgrown“ twitterte die Autorin Furaha Joyce einst und sendete damit vielmehr einen Appell, als einen bloßen Reminder in die Weiten des Internets. Die rund 58.300 Likes und 34.000 Retweets zeigen jedenfalls, dass es schon längst nicht das Problem einer einzelnen Person, sondern das von vielen ist.
Stop shrinking yourself to fit places you’ve outgrown
— Furaha Joyce (@elatedempress) February 19, 2018
Mich jedenfalls hat es zum Grübeln gebracht. Darüber, ob ich nicht vielleicht doch einmal lernen sollte, wie das so ist, mit dem bewussten Gewinnen, mit dem Auskosten von Erfolgen, mit der Überzeugung von mir selbst und diesem Mittelpunkt, in dem manche Menschen ja sogar gerne mal verweilen. Wie genau ich das anstellen werde, weiß ich noch nicht, vielleicht ist aber gerade diese Einsicht bereits der Anfang einer Veränderung.