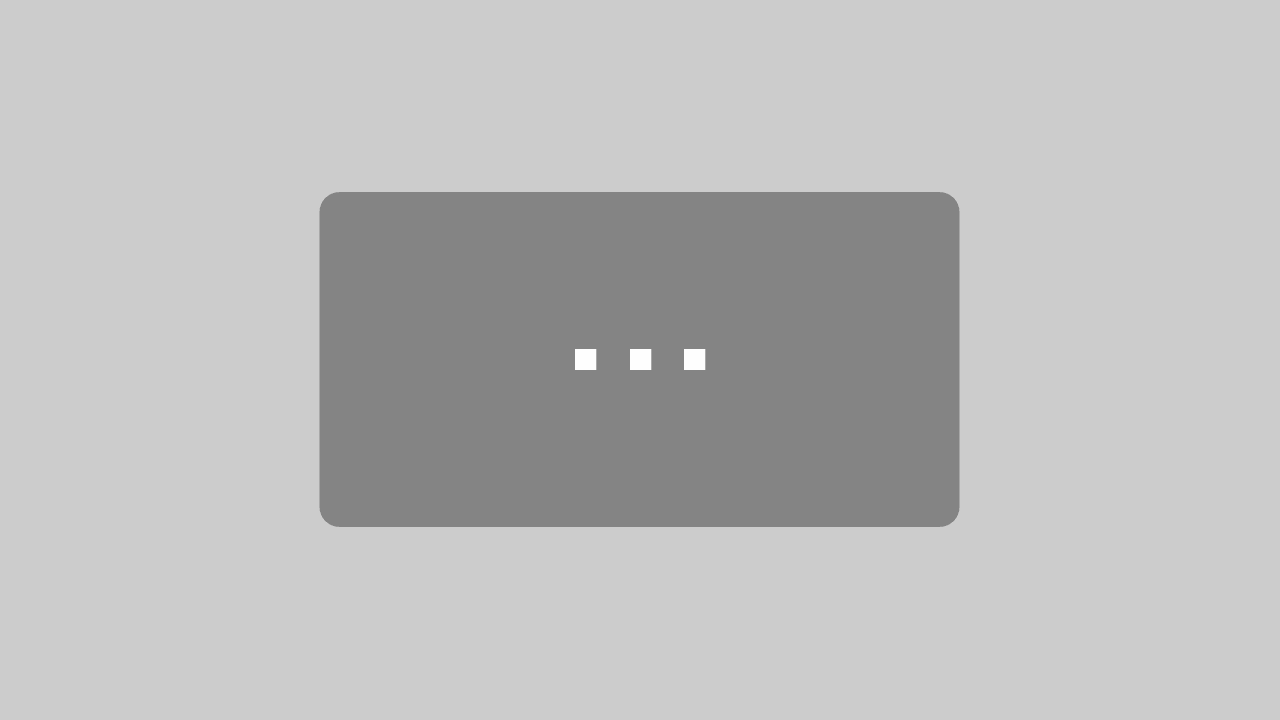The Observer, die Zeit, Pitchfork, Fräulein, Spex – sie alle sind verrückt nach ihr, nach der „Gangster Nancy Sinatra“des 21. Jahrhunderts, nach dem Mädchen mit den verspritzten Gummischlauchlippen. Wir haben gewartet. Tagelang, wochenlang. Weil wir dachten, dass wir es irgendwann verstehen würden, das Phänomen der „Lana Del Rey“. Tun wir aber nicht. Nichtmal jetzt, wo Elisabeth »Lizzy« Grant sogar schon im Mainstream angekommen ist.
Man lobt ihre Stimme, dieses raue, sebstbewusste Zischen, das plötzlich erotisierend klar wird. Man ist ihr verfallen, dieser Attitüde zwischen 60er Jahre Girlietum und roughem Hip Hop-Gehabe, die dem Pophimmel einen neuen Stern gebracht hat. Diesem schönen Biest, das uns erlösen soll von zu viel schlechter Musik und dem allgegenwärtigem Einheitsbrei. Dabei ist sie nicht anders als all die anderen, die nunal Ruhm wollen und dafür alles geben. Vielleicht ist sie klüger, vielleicht geschickter. Aber auch Lizzy aka Lana hat nicht mehr Talent als andere – sie kann bloß gut Geschichten erzählen. Und zwar ihre eigene.
Große Augen, ein großer Mund und noch mehr Haar – alles schreit nach billigem Ghetto-Blingbling – wäre da nicht dieser durchdringende Blick, diese selfmade-Optik ihrer Videos und all der süße Haarschmuck, der der Lana Del Rey davor bewahrt, sich selbst zu verramschen. Geschickt nimmt sie kurz vor dem Fall die Kurve, ist zu sehr Mädchen um Bitch zu sein, aber zu sexy um als niedlich durchzugehen. Wir können sie nicht einordnen, diese Lana Del Rey, weil sie das selbst nicht kann. Weil sie heute von ganz unten kommt und morgen von ihrem reichen Daddy singt. Sie tut uns Leid wegen ihrer puppentoten Augen, ihrer krummen Lippen. Wir hassen sie, weil sie schön ist, troz allem. Sie mag ein Genie der Selbstvermarktung sein oder kluge Manager im Rücken haben – aber all das macht ihre Musik auch nicht besser. Auch nicht neuer, nicht toller als die von Florence Welch oder BOY oder sonstwem, der von der Masse geliebt wird. Es ist genug Platz für alle da, aber Lana hatte einfach Glück. Sie ist unantastbar, nicht nett und nicht sympathisch, sondern der Star in der Ferne. Richtig so, denn die Fassade bröckelt schnell, wenn die Menschen zu viel wissen. Ist es das, was sie so groß macht? Lady Gaga als Mutter im Geiste, als Vorbild, als Kunstfigur, der es nachzueifern gilt? Mit dem eigenen Alter Ego, mit Lana Del Ray, der Ghetto-Braut mit Sinn für Retro-Romantik?
Der Plan geht auf. Es scheint, als müssten bloß die richtigen Leute über dich reden und schreiben, ein paar Opinion Leader auf dich stehen – das ist der Zündststoff der Rakete unter deinem Hintern, die dich in den Himmel katapultieren wird. Lana ist dort oben angekommen, alle Köpfe schauen zu ihr auf. Gut, Musik ist Geschmackssache – und diese hier trifft meinen nur dann und wann mal. Da hilft auch kein Dackelblick.
Nehmen wir mal „Video Games“: Ja, das ist ein tolles, ein wunderbares Lied, zweifelsohne. Bloß liegt das nicht unbedingt an Lana: Kasabian machten daraus nämlich ein ebenso gutes Cover. Sagen wir es in den Worten meines Mitbewohners: „Das ist nicht schlecht, das ist ganz gut. Aber es gibt eben 500 andere Sängerinnen, die das genau so können.“ Wir jedenfalls sind gespannt, wie lange Lana Del Rey noch Lieder schreiben wird, die ins Herz treffen. Wir gönnen ihr nämlich ihren Ruhm von Herzen, mögen sie, weil so viele sie hassen, kritisieren sie, weil uns irgendwas fehlt. Wir machen uns bloß ein bisschen Sorgen, dass es mit ihr bald so läuft wie mit Obama: Wer enormen Erwartungen ausgesetzt ist, kann eigentlich nur enttäuschen. Und wenn die Erwartungen von zu viel Hype kommen, statt von zu viel Talent, dann wackelt die Basis, bevor überhaupt jemand an ihr rüttelt.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HO1OV5B_JDw[/youtube]
Bilder: dockdrei, gigamusik, aufgemischt.