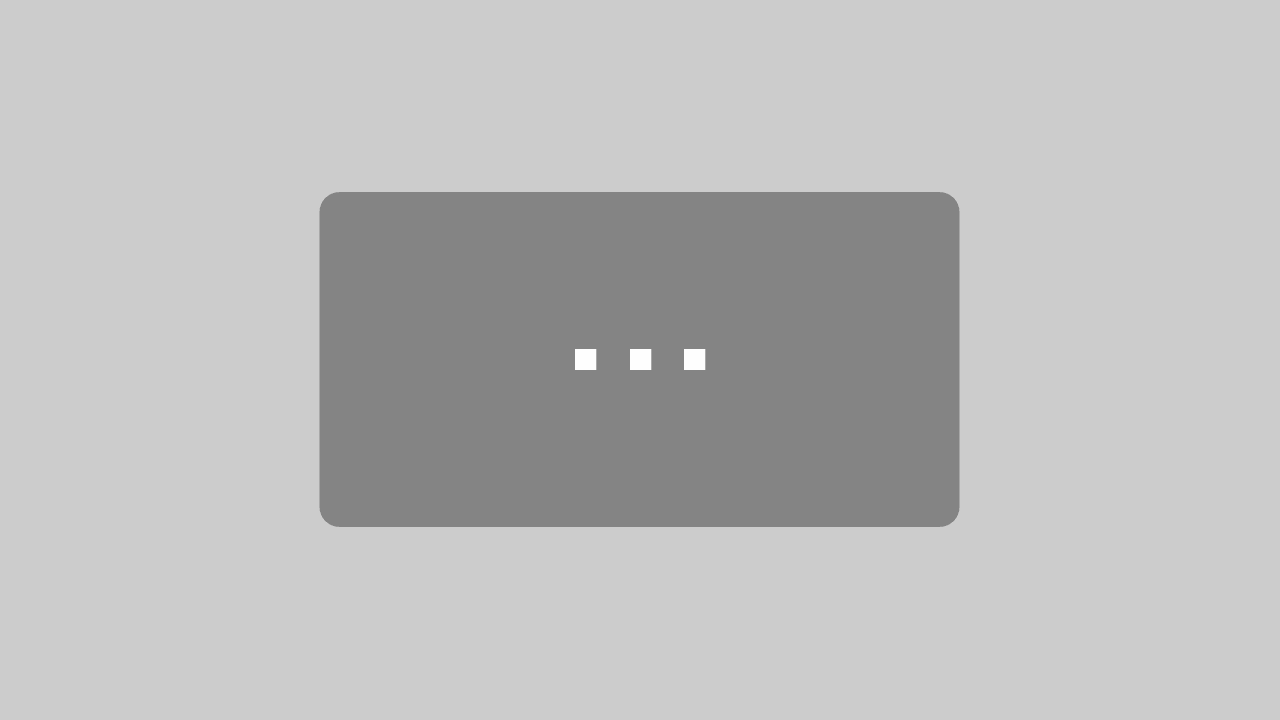Ich behaupte überhaupt nicht, dass ich immer und ausnahmslos sauber ticke, und schon gar nicht, wenn es um meinen Musikgeschmack geht. Der ist nämlich überwiegend emotionsgesteuert, was teilweise nicht nur zur kompletten Verwirrung meiner selbst, sondern auch meiner Mitmenschen führt. Schon allein die Liste meiner Lieblings-Tracks ist schwer nachvollziehbar, weil sich da Sun Ra an Brian Eno an Avey Tare an Dillinger an Baths an TLC an Hole an Gang Starr reiht. Eine bewegte Teenagerzeit führte dazu, dass ich noch heute gefangen bin in einem Tauzieh-Zustand zwischen Riot Grrrl und Hip Hop, zwischen experimentellem Jazz und „Awesome Tapes from Africa“ – Funden, zwischen Trash-Pop und Trap.
Vor allem, wenn ich über Lieblingslieder von früher stolpere, muss ich mich dann und wann doch schwer wundern. In der vergangenen Woche hörte ich „What’s Love Got To Do With It“ geschlagene 73 Mal (das Original stammt von Tina Turner). Mich wundert das erstens, weil sich mir auch beim 74. Mal noch nicht der Magen umdreht und zweitens, weil mir das Ganze schon wieder zeigt, dass die Musik, die wir hören, ziemlich häufig nicht nur Lebensabschnitt-gebunden, sondern auch Menschen-gebunden ist. Gefühlstechnisch. An wen ich bei dem Lied denken muss, verrate ich hier natürlich nicht. Viel interessanter ist allerdings das „wieso“. Ich glaube, dieser Mensch hat in meiner Anwesenheit noch nie „Warren G“ erwähnt oder gar angespielt. Wir produzieren uns dann und wann also offensichtlich unsere eigenen Geschichten zum jeweiligen Track. Und vielleicht ist das ständige Rauf-und-runter-hören nichts weiter als das Beschwören der Realität außerhalb der Musik, als ein Akt der Hoffnung und Verzweiflung, weil wir uns insgeheim wünschen, dass aus Hirngespinsten irgendwann echte Momente werden.