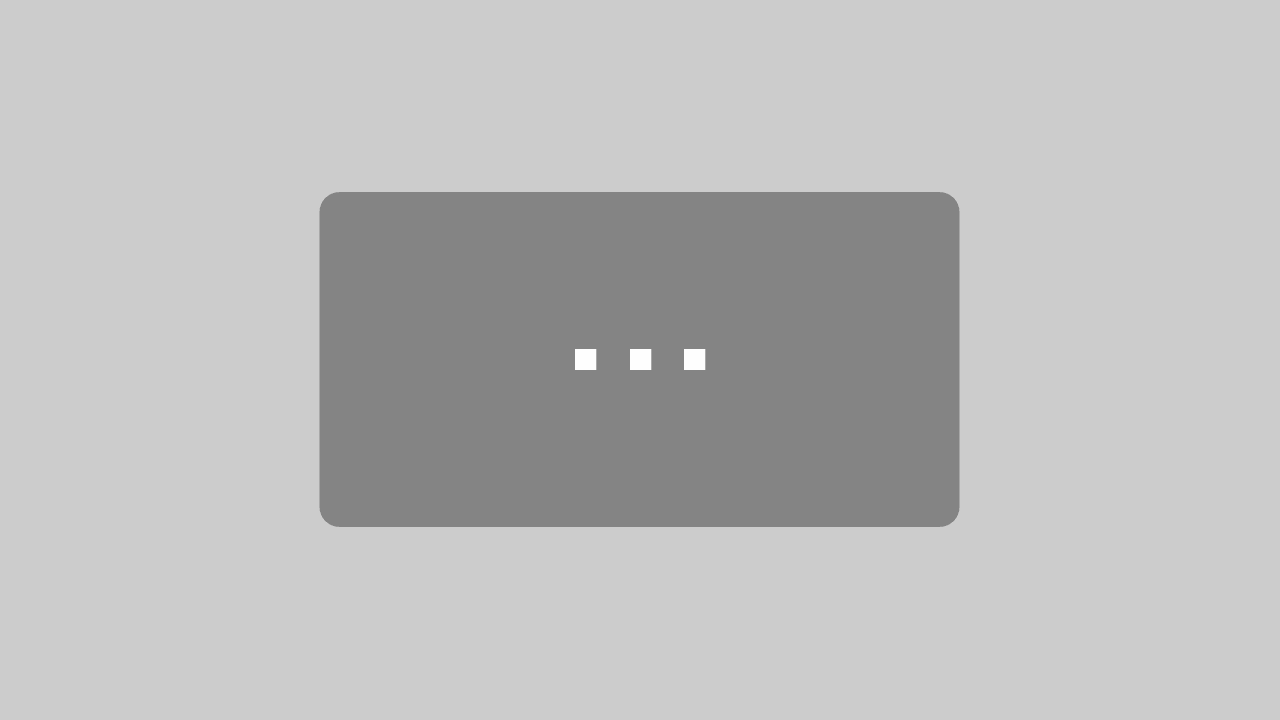Heute Morgen habe ich zugegebener Maßen keinen Empathie-Clown verschluckt. Ich sollte euch also wohl am besten schon jetzt verraten, dass ich das, was da draußen gerade im Social-Media-Land passiert, nur sehr bedingt ernst nehmen kann. Diesmal meine ich aber weder überfilterte Gesichter, noch inszenierte Momente, sondern das Spektakel, das mit dem Bekenntnis der Bloggerin Essena O’Neill einhergeht. Die Beauty-Koriphäe, die zuletzt mehr als eine halbe Million Follower auf diversen Kanälen wie Instagram und Youtube zu verzeichnen hatte und mitunter 2000€ pro stundenlang arrangiertem Schnappschuss verdiente, gelange dieser Tage nämlich zu einer bahnbrechenden Erkenntnis, die wie folgt lautet: „Social Media is not real life.“
Heute Morgen habe ich zugegebener Maßen keinen Empathie-Clown verschluckt. Ich sollte euch also wohl am besten schon jetzt verraten, dass ich das, was da draußen gerade im Social-Media-Land passiert, nur sehr bedingt ernst nehmen kann. Diesmal meine ich aber weder überfilterte Gesichter, noch inszenierte Momente, sondern das Spektakel, das mit dem Bekenntnis der Bloggerin Essena O’Neill einhergeht. Die Beauty-Koriphäe, die zuletzt mehr als eine halbe Million Follower auf diversen Kanälen wie Instagram und Youtube zu verzeichnen hatte und mitunter 2000€ pro stundenlang arrangiertem Schnappschuss verdiente, gelange dieser Tage nämlich zu einer bahnbrechenden Erkenntnis, die wie folgt lautet: „Social Media is not real life.“
Mit lautem Getöse und, natürlich, einem kurzem Clip zum glorreichen Abgang, verabschiedete sich die 18-Jährige jetzt also aus dem Web. Fast. Denn plötzlich folgen ihr mehr Menschen denn je.
Nach besagtem Video erschien schließlich relativ schnell ein zweites. Der Titel: „Overhelmed and beyond words grateful“.
Nun kann man weiter bohren und sich fragen, ob man denn, wenn man doch nunmal das Gegenteil eines „Intention Seekers“ sein will, mit dem Verbreiten dieser Botschaft nicht besser gewartet hätte, bis man leer geweint ist. Aber genau hier liegt die Krux, das traurige Dilemma vergraben. Social Media hat Essena krank gemacht, dazu bekennt sie sich jetzt öffentlich. Hungrig nach Likes und Anerkennung. Gegessen hat sie für das perfekte Bikinibild aber manchmal einen ganzen Tag lang nicht. Wieso sie sich nach einem ersten Anflug von Abstinenz nun doch weiter im Bewertungs-Sumpf suhlt, ist schnell erklärt. Sie will wachrütteln – obwohl sie dabei hin und wieder vergisst, dass gemachte Erfahrungen nicht automatisch für den Rest der Welt gelten müssen. Dem Himmel sei Dank.
Trotz ihrer nicht gänzlich kritiklos hinzunehmenden Vorgehensweise im Aufklärungskampf über die dunkle Seite der Medien spricht die Australierin mit ihren wimmernden Worten dennoch tausenden von jungen Mädchen aus dem Herzen. Oder geradewegs mitten rein. Und das ist wichtig, auch wenn ich mir gewünscht hätte, sie hätte selbiges mit mehr Selbstachtung getan.
„I’m crying because I needed to hear this when I was younger, heck anyone who spends hours and hours on a screen wishing they could have a ‚perfect‘ life, this is for you. There is nothing cool about spending all your time taking edited pictures of yourself to prove to the world ‚you are enough‘. Don’t let numbers define you. Don’t let anyone tell you you’re not enough without excessive makeup, latest trends, 100+ likes on a photo, ‚a bikini body‘, thigh gap, long blonde hair. I was born into the flesh I have, there is nothing inspirational about that. I am just so grateful to think of how many young men and women might see this movement and stop limiting themselves to artificial ideas of happiness online. When you stop comparing and viewing yourself against others, you start to see your own spark and individuality. Everyone has love, kindness, creativity, passion and purpose. Don’t let anyone sell you something different.“
Statt sich weiterhin auf ein Ideal reduzieren zu lassen, das sie selbst nur mit viel Mühe erreichen kann, widmet sich Essena ab sofort ihrer neuen Website „Let’s be game changers“. Hier spricht sie nicht nur über ihre persönliche Geschichte, sondern auch über das Business hinter den bunten Bildern. Ältere Instagram-Bilder löscht sie derweilen oder versieht sie mit neuen Unterschriften. Wie beispielsweise jene, die sie am weißen Sandstrand beim Yoga zeigen: „There is nothing zen about trying to look zen, taking a photo of you trying to be zen and proving your zen on Instagram.“ Na also. Wieso nicht gleich so.

Aber zurück zum Anfang und einer Textpassage, die ich bei Edition F gefunden habe:
„(…) Diese Wettbewerbe um „Likeability“ sollte man jedoch nicht ausschließlich negativ sehen: Denn das Netz ist unglaublich vielfältig ist und es ergeben sich zahlreiche Communitys, in denen Schönheit jenseits gängiger Normen neu definiert wird und somit das Selbstbewusstsein von Menschen gestärkt werden kann, die in ihrem natürlichen sozialen Umfeld ausgegrenzt wurden. Viele Feministinnen betrachten die Selfie-Kultur daher als etwas, das sich positiv auf das Leben von Mädchen auswirken kann. Kann (…)“
Was bringt uns am Ende also das Verteufeln einer ganzen Welt, die sich nicht mehr auslöschen lässt. Viel? Wenig? Gar nichts? Zum ersten Mal seit Langem sitze ich etwas ratlos hier. Ich halte noch immer an meinem Gedanken fest, dass nicht die Bilder das Problem sind, sondern wir selbst. Kann es uns tatsächlich nur besser gehen, wenn wir uns im Angesicht digitaler Perfektion immer wieder das Mantra „This is not real life“ aufsagen? Was, wenn es irgendwo auf Bali aber wirklich eine gertenschlanke Blondine gibt, die ihren eigenen Traum lebt, dabei glücklich ist und noch dazu gut aussieht? Sind wir dann verloren? Geht es nicht vielmehr darum, endlich zu kapieren und akzeptieren, dass nicht nur Körper, sondern auch Lebensentwürfe, Wohnzimmer und Ehemänner in ziemlich vielen Formen und Farben daher kommen?
Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mit Instagram sehr viel Geld verdient. Die mehrere hunderttausend Follower hat. Und trotzdem dokumentiert sie ihr schönes Leben, statt sich zu Dokumentationszwecken eines aus Schall und Rauch zusammen zu bauen. Ich weiß, dass sie nur die aufgeräumten Ecken ihrer Wohnung fotografiert, so wie es die meisten von uns tun. Aber wollen wir denn ernsthaft Katzenkratzbäume und Wäscheberge sehen? Einige wohl schon, denn alles ist besser für die Seele als fremde Schein-Makellosigkeit.
Mittlerweile hat sich beispielsweise die Österreichische Bloggerin Madeleine Alizadeh dazu beflügeln lassen, ihren Followern auf Instagram eine Woche lang nichts als die Wahrheit zu zeigen. #meinlebenohnefilter. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll, wahrscheinlich aber gut, wir kennen unsere liebe @Dariadaria ja. Bloß geht es dann in sieben Tagen weiter wie zuvor. Ich persönlich werde mich darüber freuen, Realität habe ich meinem Leben nämlich schon genug.