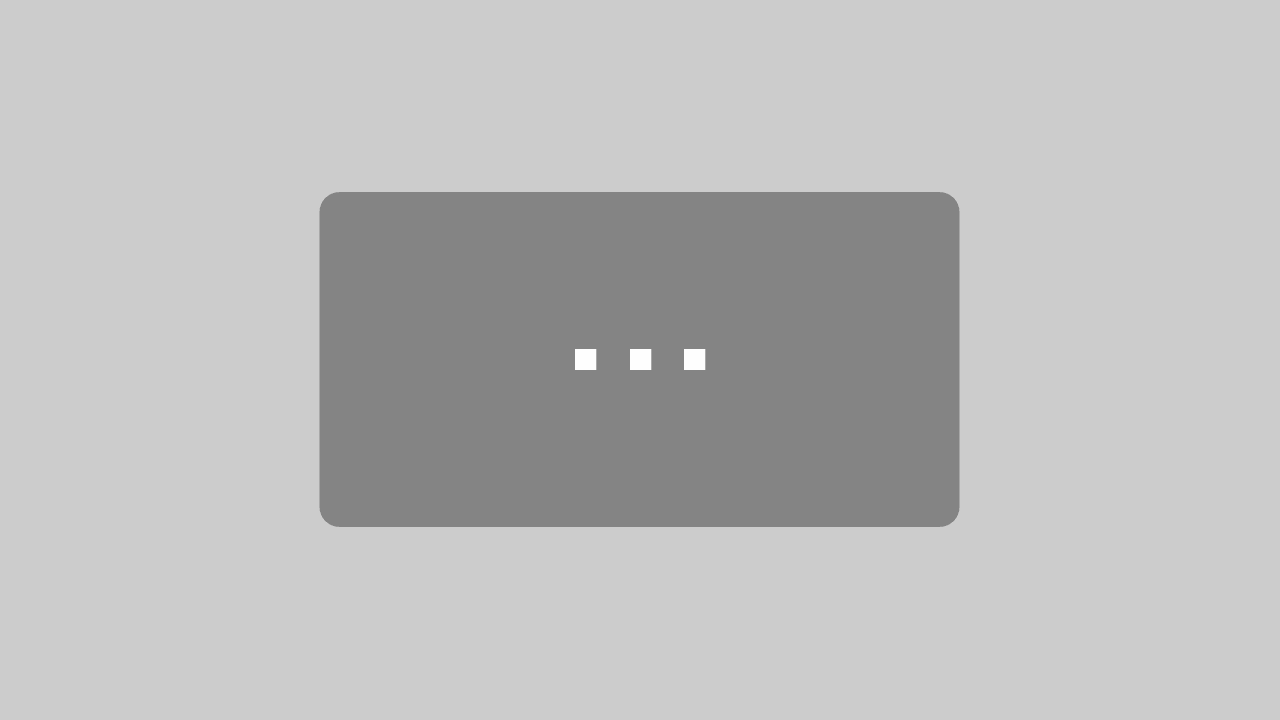Ein paar Gedanken, vier Tage nach dem Attentat.
Vier Tage ist das Attentat mittlerweile her. Ach, was heißt hier Attentat. Das klingt noch viel zu harmlos. In Wirklichkeit reden wir nicht von einem Attentat, sondern vom größten Hass-Verbrechen an der LGBT-Gemeinde seit dem Zweiten Weltkrieg. 53 Menschen sind verletzt, davon viele schwer. 49 sind tot. Umgebracht innerhalb weniger Stunden von einem, der in blindem Hass auf jene schoss, die er als anders, als bedrohlich empfand.
Vier Tage nach diesem Verbrechen kommen immer neue Details ans Licht. Über die Opfer. Über den Täter. Vor allem über den Täter: Omar Mateen, 29 Jahre alt, US-Amerikaner mit afghanischen Wurzeln. Er soll einen Treueschwur auf den sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) geleistet haben, diese international operierende Mordmaschinerie. Mateen, so ist der aktuelle Stand, scheint sich alleine, im stillen Kämmerlein radikalisiert zu haben. Er brauchte kein IS-Ausbildungscamp, er brauchte nur das Internet. In amerikanischen Medien wird spekuliert, Mateen sei selbst homosexuell gewesen: ein radikaler Islamist, der mit seiner eigenen Sexualität nicht klar kam. Wissen werden wir es wahrscheinlich nie – Mateen ist der 50. Tote bei dem Massaker im Pulse, erschossen von der Polizei.
Latente LGBT-Feindlichkeit
Was wir aber wissen: Omar Mateen mag derjenige gewesen sein, der zur Waffe griff und seine Mordfantasien auslebte – sein Hass auf die LGBT-Gemeinde ist aber nichts Ungewöhnliches. In den USA ist er vielmehr salonfähig. Da wird homosexuellen Paaren die Trauung verweigert, Transmenschen wird vorgeschrieben, welches Klo sie zu benutzen haben und Evangelikale verkünden regelmäßig, alles jenseits von Heterosexualität und-normativität sei eine Sünde. In Deutschland haben wir keine evangelikalen Hassprediger, aber im LGBT-Traumland leben wir hier auch nicht.
Kurz nach dem Attentat im Pulse schrieb mir ein Bekannter eine traurige Nachricht. Er identifiziert sich als genderqueer: An manchen Tagen trägt er einen Anzug, an anderen ein Kleid. Orlando hat ihn sehr mitgenommen, denn auch er erlebt in der deutschen Kleinstadt, in der er studiert, Diskriminierung – weil er ein Kleid und eine Perücke trägt, wenn er da gerade Lust drauf hat, und weil andere Menschen sich deswegen über ihn lustig machen, ihn beschimpfen. Orlando ist für ihn im gewissen Sinne sehr nah – viel näher, als ihm lieb ist. Deutschland habe ein großes Problem mit latenter LGBT-Feindlichkeit, sagt er und dass das viel zu wenig diskutiert werde.
Prüde, zickig, „Homos“
Ich kenne Männer, die es nicht ernst nehmen, wenn eine Frau lesbisch ist. Die denken: Der ist nur noch nicht der Richtige begegnet. Die immer davon ausgehen, dass lesbische Sexualität etwas ist, was Frauen für Männer inszenieren. Zwei Frauen, die sich in einer Bar küssen? Heiß! Wenn diese Frauen aber danach nicht bereit sind, Männer in ihre Make-Out-Session miteinzubeziehen, sind sie ganz schnell prüde, zickig, „Homos“. Von Homosexuellen wird entweder erwartet, dass sie dem Klischee entsprechen („Der redet schon so tuntig“) – oder, dass sie dem Klischee eben nicht entsprechen („Ich finde es gut, dass du für eine lesbische Frau so gar nicht männlich wirkst“). Bisexuelle gelten wahlweise als hemmungslos („Die können ja theoretisch mit jedem ins Bett gehen!“) oder faul („Die wollen sich doch nur nicht entscheiden.“).
Dass meine Oma über Homosexuelle sagt, diese seien „verkehrt herum“ und findet, Männer sollten sich in der Lindenstraße nicht küssen, weil, da könnten ja Kinder zusehen, ist die eine Sache. Meine Oma ist Mitte 80. Die andere Sache ist, dass auch viele Menschen meiner Generation eimerweise Klischees verbreiten, wenn es um LGBT gehen – und so tun, als sei alles, was nicht weiblich/männlich und heterosexuell sei, eben queer, irgendwie die Ausnahme, irgendwie exotisch. Auch in Deutschland halten schwule Paare auf der Straße lieber nicht Händchen. Auch in Deutschland sagt meine lesbische Freundin ihrem Chef lieber nicht, dass sie sich in einer festen Beziehung mit einer Frau befindet. Auch in Deutschland trauen sich viele Menschen nicht, ihre Geschlechtsidentität offen auszuleben.
Liebe allein hilft manchmal nicht
Wenn wir über Orlando sprechen, müssen wir über viele Dinge sprechen. Wir müssen über Waffengesetze sprechen, mal wieder. Wir müssen über islamistischen Terror sprechen, mal wieder. Wir müssen über Religion und Integration sprechen, mal wieder. So viele Themen, die zusammenhängen, die miteinander gedacht werden müssen. „Love trumps hate“ lautet die optimistische Botschaft, die nun durch die sozialen Netzwerke wandert. Die traurige Wahrheit ist: Liebe hilft nicht gegen den internationalen Terror. Sie hilft auch nicht gegen die latente oder offene Diskriminierung von LGBT. Ehrlich gesagt, ich weiß gerade nicht, was hilft. Aufklärung vielleicht. Hinschauen, den Mund aufmachen. Eigene Vorurteile hinterfragen. Vielleicht. „Love trumps hate“. Ich würde da gerne dran glauben.
Von Julia Korbik.
Julia Korbik (*1988) lebt als freie Journalistin und Autorin in Berlin. 2014 erschien ihr Buch Stand Up. Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene (Rogner & Bernhard). Julia ist Gründerin und zuständige Redakteurin von Mind the Gap, der Gender-Rubrik des sechssprachigen Europa-Onlinemagazins cafébabel. Auf ihrem Blog Oh, Simone dreht sich alles um die französische Schriftstellerin und Philosophin Simone de Beauvoir.
Alle Artikel von Julia auf einen Blick.