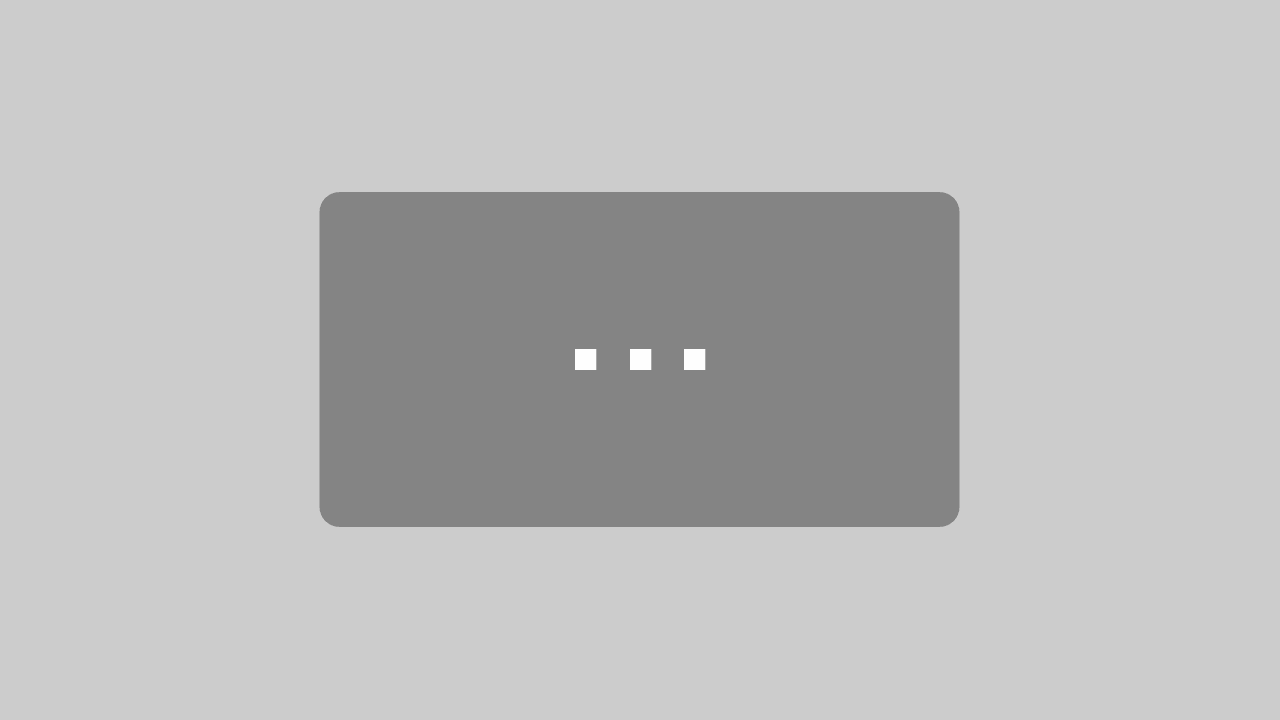H&M hat es geschafft, binnen weniger Stunden mehr als 1.000.000 Klicks zu generieren, das gerade erschienene Kampagnenvideo zur Herbstkollektion 2016 scheint demnach ein wahrer Glücksgriff des schwedischen Regisseurs Gustav Johansson geworden zu sein, jedenfalls für die Werbetrommel. Im Netz wird gejubelt, Screenshots des Spots und der dazugehörige Hashtag #Ladylike machen sich auf allen gängigen sozialen Plattformen breit, man dankt dem Moderiesen sogar ganz öffentlich und überaus vielfach. Für das Abstand nehmen vom Propagieren eines immer gleichen Schönheitsideals, für das Zelebrieren der weiblichen Vielfalt und für seinen Mut, es anders zu machen als all die anderen Saftsäcke diverser Megakonzerne, die optisch noch immer fröhlich von einer potentiellen Anorexie zur nächsten stolpern. Auch ich konnte die Füße kaum still halten, als plötzlich das Lion Babe-Remake von „She’s a lady“ samt passendem Lebensgefühl aus dem Lautsprecher dröhnte, während sich die vermeintlichen coolsten Girls des Planeten noch dazu auf meinem Bildschirm tummelten, eine schöner als die andere. Da will man es ihnen alsbald gleichtun, keine Frage. Marketing-Mission geglückt, trotz des berechtigten Vorwurfs des Fame-inismuses, der schon bei Acne Studios auftauchte. Hunger bekomme ich ebenfalls, es gibt da etwa Pommes im Bett, gesunde Körper verschiedenster Coleur und ästhetisches Achselhaar zur Erdbeer-Shake-Tönung. Ich möchte H&M für diese 92 Sekunden küssen, wirklich. Aber nur fast ohne aber.
Es ist nicht so, als hätten sich in meinem Hirn nicht ähnliche Gedanken getummelt, wie jene, die gerade von der wunderbaren Josefine Schummeck in einem offenen Brief an das Unternehmen kundgetan wurden, auch ich hätte mehr in Interesse an mehr Lohn für die Näherinnen als an einem Augenschmaus und Statement wie dem hier gezeigten, doch bin ich diesmal der Meinung, es mit zwei sehr unterschiedlichen Baustellen zu tun zu haben. Auf der einen Seite steht die konzerninterne Ausbeutung etlicher Niedrig-Lohn-Arbeiter*innen, die dringend bekämpft werden muss und sich wie ein Schatten über jeden Versuch des Aufbegehrens legt, auf der anderen Seite steht das unerreichbare, verklärte Frauenbild, das nicht minder ausgemerzt gehört. Man kann jetzt natürlich zurecht behaupten, erstere Problematik gehöre unweigerlich auf Platz 1 der Prioritätenliste, das stimmt, aber auch dieser womöglich längst eingetroffene Umstand würde rein gar nichts an der Langwierigkeit des damit verbundenen Änderungs-Prozesses hin zu einer faireren Branche ändern. Punkt Nummer Zwei hingegen war ebenfalls längst überfällig, der abgemagerte Heroin Chic ist jetzt schließlich schon gut 20 Jahre alt, ganz zu schweigen davon, dass man mit hochglänzender Makellosigkeit inzwischen wirklich nur noch den Bodensatz der denkenden Masse zu beeindrucken vermag. An einem Umstand lässt sich trotzdem nicht rütteln: Eine Veränderung der Bildsprache ist für eine steinreiche Marke wie H&M so leicht umzusetzen, dass man sich fragt: Wieso erst jetzt? Es kommt mir mehr als perfide vor, im Jahr 2016 noch so etwas wie „Dankbarkeit“ für diesen „wichtigen und mutigen Schritt“ hin zu mehr Vielfalt in der Werbung zu empfinden. Dass wir es überhaupt für erwähnenswert betrachten, Lobeshymnen für das Abbilden der Realität auszusprechen. Dass Magazine Sätze aufschreiben wie „Auch alle anderen Frauen, die in dem Spot zu sehen sind, brechen mit bisherigen Konventionen: Sie tragen kurze Haare, haben Achselhaare und Muskeln. Sie küssen andere Frauen, sind Transgender und essen genüsslich Pommes im Bett – Frauen, die sich wohlfühlen, ohne dabei konventionellen Rollenbildern zu entsprechen.“ Von welchen Konventionen ist hier denn die Rede? Kurze Haare? Pommes im Bett? Revolutionär. Jedenfalls wenn man vorher einen riesigen Schritt zurück gemacht hat.
Und doch wäre es vermessen, H&M nun an den Pranger zu stellen. Ganz so, als würde man einem Kleinkind das Krabbeln untersagen, wo es doch auch gleich mit dem Laufen beginnen könnte. Nur, dass wir es hier eher mit einem Erwachsenen zu tun haben, der selbst einen Marathon schaffen würde. Ähnlich erschreckend bleiben weiterhin die Reaktionen der Rezipienten, der Zielgruppe fernab der aufgeklärten Kirsche auf der Sahnetorte der Durchschnitts-Konsumenten. Die echauffieren sich auch heute noch über Haare an Frauenkörpern, über die Zumutung namens Speckröllchen und „Menschen, die nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind“. Ich erinnere mich da beispielsweise an einen Kommentar der Grazia zur Lingerie-Werbung, in der Lena Dunham samt Bauch lasziv am Badewannen-Rand posiert. „Das wolle ja nun wirklich niemand sehen.“ Das sind Aussagen, die wirklich traurig stimmen sollten, das ist die andere Realität. Ein Beweis dafür, dass Kampagnen wie die hier diskutierte offenbar noch immer als optisch außergewöhnlich betrachtet werden. Wegen der Photoshop-Vergiftung, der unsere Augen jahrelang unterlegen waren und vielleicht noch immer sind. Magazine, auf deren Titel schwarze Frauen strahlen werden noch immer seltener verkauft. Plus-Size-Models werden von den Medien gefeiert, als seien sie rares Gut und von Betrachtern heimlich hämisch beäugt. Die Brigitte versagte mit dem Versuch, „echte Menschen statt Models“ in Editorials zu platzieren, die Leserinnen nahmen die neue (Schein-)Natürlichkeit nicht an. Am Ende will man eben doch ein Stückchen vom Vogue-Wunderland naschen, statt einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Noch. Wir tragen also unweigerlich eine Mitschuld an der Misere, lebendige Kampagnen mit einer derartigen Wucht zu überhypen, statt sie als selbstverständlich zu verstehen. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Der H&M-Realitäts-Check etwa scheitert trotz bester Intentionen schon im nächsten Laden: In nur sieben von 35 H&M-Shops in New York City wird tatsächlich die „Plus-Size-Kollektion“, deren Name übrigens ebenfalls streitbar ist, verkauft (Quelle). In Deutschland sieht es ähnlich aus. Wir sollten die Diversität womöglich endlich anfangen zu leben, statt ständig nur über sie zu reden.