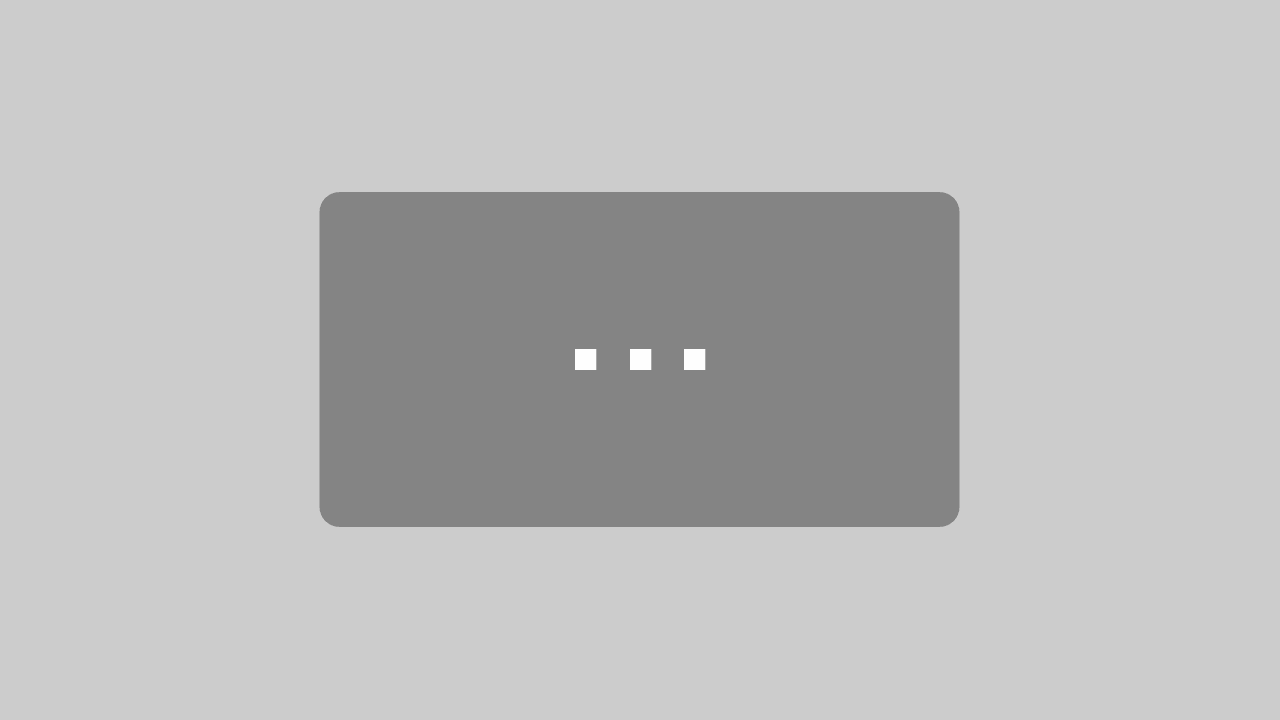Ehrlich gesagt: Ich hatte Angst, mir diese Serie anzugucken. Weil das Buch, auf dem die Serie basiert, zu meinen Lieblingsbüchern gehört und darin jedes Wort, jeder Satz perfekt ist. Weil es Anfang der 1990er bereits eine Verfilmung von The Handmaid’s Tale gab und ich die ziemlich misslungen fand. Aber nachdem die Hulu-Serie mit Elisabeth Moss (Peggy aus Mad Men) in der Hauptrolle monatelang angeteasert wurde, konnte ich nicht widerstehen. Ich schaltete ein – und bin froh darüber.
Ehrlich gesagt: Ich hatte Angst, mir diese Serie anzugucken. Weil das Buch, auf dem die Serie basiert, zu meinen Lieblingsbüchern gehört und darin jedes Wort, jeder Satz perfekt ist. Weil es Anfang der 1990er bereits eine Verfilmung von The Handmaid’s Tale gab und ich die ziemlich misslungen fand. Aber nachdem die Hulu-Serie mit Elisabeth Moss (Peggy aus Mad Men) in der Hauptrolle monatelang angeteasert wurde, konnte ich nicht widerstehen. Ich schaltete ein – und bin froh darüber.
Denn The Handmaid’s Tale ist so mit das Beste, was die übergroße Serienlandschaft gerade zu bieten hat. Das liegt vor allem an der Dringlichkeit und Aktualität, die die Serie vermittelt, daran, dass sie die Frage nach dem „Was wäre, wenn…?“ so eindrücklich und schonungslos beantwortet. Die Geschichte selbst spielt in der nahen Zukunft, in der Republik Gilead: Durch nukleare Katastrophen ist ein Großteil der US-Bürger*innen unfruchtbar geworden, die Geburtenrate sinkt dramatisch. Es kommt zu einem Staatsstreich durch die christlich-fundamentalistische Gruppe Sons of Jacob, die den Präsidenten sowie den gesamten Kongress ermordet, die Verfassung außer Kraft setzt und die Republik Gilead auf dem Territorium der ehemaligen USA errichtet. In atemberaubendem Tempo wandeln die Sons of Jacb das Land in eine christliche Militär-Diktatur um, in der Frauen keine Rechte haben. Die neuen Gesellschaftsstrukturen orientieren sich an Stellen aus dem Alten Testament und weisen allen Menschen bestimmte Rollen zu. Die herrschende Klasse hält sich sogenannte Handmaids: fruchtbare Frauen, die den jeweiligen Haushalten – bestehend aus einem Commander und dessen Frau – zugewiesen werden, um ihnen Kinder zu gebären.
Bedrückender Alltag
Offred, aus deren Perspektive The Handmaid’s Tale erzählt wird, ist eine dieser Gebärmaschinen und muss regelmäßig an einer pseudo-religiösen Zeremonie teilnehmen, während der sie mit dem Commander schlafen muss – de facto sexualisierte Gewalt, von ganz oben abgesegnet. Offred, die Commander Fred dient (daher ihr Name: Of-Fred), hat sich mit ihrem Schicksal abgefunden, ist keine Rebellin. Doch manchmal, da denkt sie an Zeiten, als alles noch anders war. Als sie einen anderen Namen hatte, eine kleine Tochter, einen Ehemann, einen Job: ein normales Leben. Als Frauen noch lesen und arbeiten durften, joggen gingen und mit ihren Freundinnen Kaffee tranken. Diese Erinnerungen sind Offreds einzige Fluchten aus ihrem bedrückenden Alltag. Das, und die sarkastische Stimme in Offreds Kopf, mit der sie gedanklich ihre Umgebung analysiert.
Margaret Atwood, die ihr Buch The Handmaid’s Tale Mitte der 1980er veröffentlichte, beschreibt die Welt von Gilead mit klaren, ausdrucksstarken Worten. Vieles wird nur angedeutet, vieles bleibt vage. Gerade deshalb entwickelt das Buch nach und nach eine Sogwirkung, der man sich als Leser*in kaum entziehen kann. Wenige Sätze reichen Atwood, um grundlegende Aussagen über das Setting und die Protagonistin zu machen: „A chair, a table, a lamp. Above, on the white ceiling, a relief ornament in the shape of a wreath, and in the center of it a blank space, plastered over, like the place in a face where the eye has been taken out. There must have been a chandelier, once. They’ve removed anything you could tie a rope to.”
Trügerisch harmonische Atmosphäre
Bruce Miller schafft es in seiner Serie für den US-Streamingdienst Hulu, Atwoods Sprache in verstörende, klaustrophobische Bilder zu übersetzen. Gilead ist in weiches Licht getaucht, was eine trügerisch harmonische Atmosphäre schafft, nahezu pittoresk. Alles wirkt irgendwie verwaschen, schläfrig. Doch dann sind da die Handmaids in ihren blutroten Uniformen, das schwarz gekleidete Militär an jeder Ecke, die weißen Säcke, die man gehängten Verräter*innen (zum Beispiel Doktor*innen, Andersgläubigen oder Homosexuellen) über den Kopf gestülpt hat. Rechte, die einmal erkämpft wurden, das macht The Handmaid’s Tale ganz deutlich, können genauso schnell wieder außer Kraft gesetzt werden. Die Rückblenden sind deshalb oft besonders brutal – weil sie zeigen, was war und was jetzt ist. Weil sie zeigen, wie schnell es gehen kann. Aber nicht nur der Blick in die Vergangenheit, unsere Gegenwart, ist schwer erträglich, auch die Darstellungen von Offreds Leben in Gilead sind es. Aus diesem dystopischen Albtraum gibt es kein Entrinnen und bei der ein oder anderen Szene wurde mir richtig übel. Nicht, weil diese Szenen auf Gewalt setzen oder auf Schockmomente, sondern weil sie sich so realistisch anfühlen. So, als könnte es wirklich so sein.

Der Dreh zu The Handmaid’s Tale hatte schon längst begonnen, als Donald Trump im November 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde. Die Serie hat sich ihre Aktualität also nicht unbedingt ausgesucht es ging ihr sicher nicht darum, einen Kommentar zur trumpschen Politik zu liefern. Doch genau das tut sie. Wer sieht, wie Offred und die anderen Frauen erst das Recht verlieren, ein eigenes Konto zu führen, dann das Recht, arbeiten zu gehen und schließlich jegliches Recht am eigenen Körper, der kann nicht umhin, Parallelen zu der Art von Politik zu ziehen, wie sie die US-Regierung gerade durchzieht: Der latente und offene Sexismus, mit dem Trump und seine Kollegen Frauen begegnen, die Einschnitte in die Gesundheitsvorsorge von Frauen, ein in vielen Staaten erneut drohendes Abtreibungsverbot. Eine der Szenen aus The Handmaid’s Tale könnte geradewegs von einem der vielen Women’s Marches im Januar 2017 stammen, auf denen weltweit Menschen gegen Trump demonstrierten. In der Serie wird die Demonstration brutal niedergeschlagen, Offred – damals noch June – und ihre Freundin Moira fliehen vor den Schüssen.
Veränderter Kontext, gleiche Bedeutung
Ja, The Handmaid’s Tale macht Angst und sie macht mich als Zuschauerin fertig. So richtig. Denn die dort dargestellte Gesellschaft befindet sich nicht in der fernen Zukunft, ist nichts völlig Ausgedachtes. Atwood beschreibt nichts, was nicht so oder so ähnlich in der Menschheitsgeschichte bereits passiert ist. All diese Geschehnisse hat sie gesammelt und in eine Erzählung eingebunden – der Kontext mag sich geändert haben, die Bedeutung aber nicht. In einem Essay für die New York Times macht Atwood klar, dass sie sich an vielen Orten Inspiration für ihr Buch geholt hat, unter anderem bei einem Aufenthalt im damals noch geteilten Berlin. Atwood sagt, besonders wichtig seien für sie Augenzeugenberichte gewesen, und schlägt den Bogen zwischen Offreds fiktiver und der realen Situation: „In the wake of the recent American election, fears and anxieties proliferate. Basic civil liberties are seen as endangered, along with many of the rights for women won over the past decades, and indeed the past centuries. In this divisive climate, in which hate for many groups seems on the rise and scorn for democratic institutions is being expressed by extremists of all stripes, it is a certainty that someone, somewhere — many, I would guess — are writing down what is happening as they themselves are experiencing it. Or they will remember, and record later, if they can.”
The Handmaid’s Tale zeigt somit auch, welche Macht Erinnerungen haben können, das simple Festhalten dessen, was geschieht. Es geht darum, die Dinge nicht als selbstverständlich hinzunehmen, gerade, wenn es um Menschenrechte geht. Das alles macht aus The Handmaid’s Tale eine wichtige Serie – aber eben auch eine, die nicht leicht anzuschauen ist.