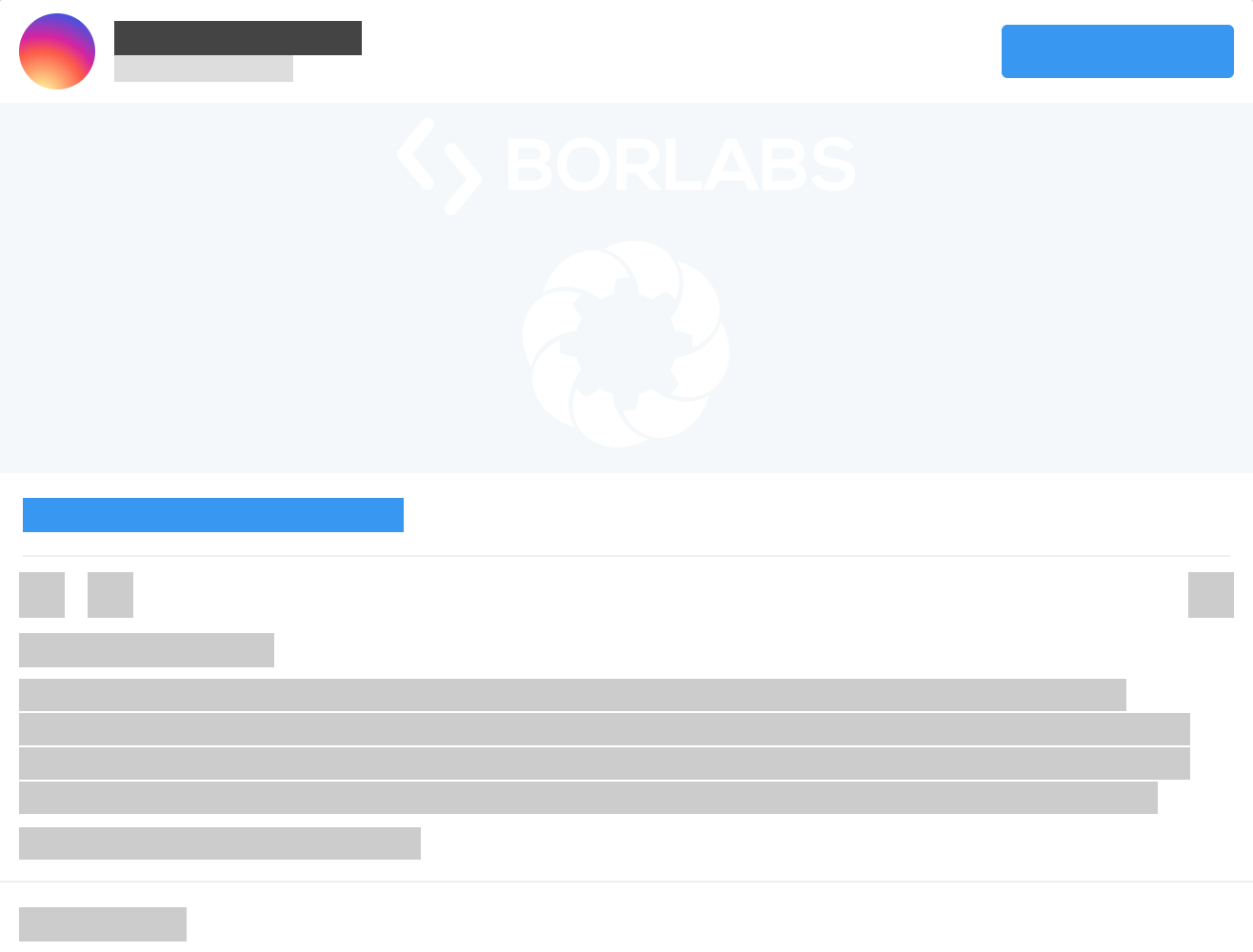Warum wir über mentale Gesundheit reden müssen? Warum es wichtig ist, das Thema in die Mitte zu stellen, zwischen uns, es immer wieder auf den Tisch zu bringen, es wirklich ernst zu meinen, wenn wir fragen, wie es unserem Gegenüber gerade geht? Weil sich vermutlich Weniges heilender anfühlt, als am Ende zu verstehen, dass man mit seinen Sorgen und Problemen, seinen Ängsten und Unsicherheiten nicht alleine ist. Dass man nicht die Erste und Einzige ist, die den Schritt in die Psychotherapie wagt, dass viele da draußen allmählich nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Denn: Tatsächlich hat einer von vier Menschen mit psychischen Problemen zu tun. Ein Tabu-Thema sollte alles, was damit zusammen hängt, also längst nicht mehr sein. Nein, im Gegenteil! Raus damit. Auch, oder vor allem im eigenen Freundeskreis. Denn Freunde ersetzen vielleicht keine Therapie, und das sollten sie auch nicht, aber sie können uns empowern, uns stundenlang die Hand halten und uns wieder auf die Beine helfen – wir müssen es bloß auch selbst zulassen. Und uns endlich trauen, die Unterstützung einzufordern, die wir brauchen. Oder?
Wir haben 5 Menschen gefragt, was für eine Rolle psychische Probleme in ihrem Freundeskreis spielen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ava, 24, aus Bern
Ich hatte schon immer destruktive Kräfte in mir. In Situationen, in denen meine Verzweiflung Überhand gewann, ging ich schon Mal mit einem Hammer durch mein Elternhaus und schlug alles kurz und klein. Mit ungefähr 14 Jahren begann ich dann, mich selber zu verletzen. Mir ging es sehr schlecht, aber ich wusste nicht wieso. Ich hörte von den „Emos“ und dass die sich ritzen, probierte es aus. Erstaunlich, was für einen großen Einfluss die Außenwelt haben kann. Die Schnitte wurden immer mehr und immer tiefer, zudem häuften sich meine Äusserungen und Gedanken zu und an Suizid. Ich merkte, wie sich meine engsten Freundinnen immer mehr distanzierten. Irgendwann dann nahmen sie mich jedoch zur Seite, das heißt, wir trafen uns in der Wohnung von zwei Freundinnen, die zu dem Zeitpunkt zusammenwohnten. Das was folgte, war sehr, sehr hart für mich, aber so geschah auch eine extrem wichtige Wendung in meinem Leben. Sie machten reinen Tisch. Und zwar ganz schön radikal. Wir waren jung, deshalb waren wir im Umgang mit solchen Themen wenig sensibel. Sie sagten also, dass sie die Schnauze voll von meinem Getue hätten, dass ich mich endlich zusammenreißen solle, dass ich nicht die Einzige hier sei, die verdammte Probleme habe und dass ich eine unglaubliche Egoistin sei. Das will man natürlich nicht hören und im ersten Moment hilft es wenig. Aber sie hatten ja Recht. Eine von uns kämpfte zu diesem Zeitpunkt mit einer Essstörung, eine andere hatte ebenfalls große Mühe mit Selbstverletzung. Es war vielleicht egoistisch, froh darüber zu sein, nicht die Einzige mit Problemen zu sein, aber gleichzeitig fühlte ichmich auch sicherer und verstandener. Für mich war aber mein eigener Schmerz und meine Depression aber erstmal so allumgreifend, dass es mir nicht möglich war, dies zu erkennen. Nachdem all diese harte Kritik auf mich niedergeprasselt war, war ich schockiert. Aber es brachte mich nach einigen Tagen und inneren Kämpfen dazu, meiner Psychiaterin von meinen Selbstmordgedanken zu erzählen und auch davon, wie ich es ein paar Jahre zuvor schon probiert hatte. Das war ein großer Schritt. Ich begann schließlich mit der medikamentösen Behandlung gegen die ich mich lange gewehrt hatte. Ich begriff, dass ich eine Krankheit habe und dass ich mir helfen lassen muss. Dass niemand einfach so mit einer solchen Krankheit leben muss und dass der Kopf genau so krank sein kann wie der Körper. Dass meine Freundinnen nur so hart zu mir waren, weil sie nunmal echte Freundinnen waren und nicht nur solche, die bei Sonnenschein da sind. Ich begann meine Aggressionen auf mich selber und die Welt immer mehr in körperliche Aktivitäten umzuwandeln…gut und schlecht…denn wenn ich alleine Sport machte, trainierte ich über meine Kapazität heraus und schlug in Wände statt in Boxsäcke. Es gab Rückschläge. Aber es wurde auch viel, viel besser. Auch, weil ich mich mit meinen Freundinnen in ruhigeren Minuten immer wieder aus tausche – über unsere psychischen Verfassungen. Jede von uns geht oder ging in Therapie. Jede von uns ist aber gleichzeitig auch Therapeutin für die jeweils anderen und umgekehrt. Ich bin eigentlich kein Fan von Worten und Tatsachen, die man mir (sehr unsensibel) ins Gesicht knallt, trotzdem war es für mich in dem Moment der einzige Weg, wirklich etwas in Angriff zu nehmen. Im Gegensatz zu meinen Eltern, die mich komplett verzweifelt und am Boden zerstört mit Samthandschuhen anfassten. Das hat niemandem von uns geholfen. Heute bin ich im Großen und Ganzen stabil. Und meine Freundinnen hab ich, genau, auch noch.
Olivia, 32, aus München
Meine kleinste Schwester war 11 Jahre alt, als sie aufhörte zu essen. Sie tanzte zu dieser Zeit leidenschaftlich Ballett und war sehr ehrgeizig. Ihr ist aufgefallen, dass nur die dünnsten Mädchen der Gruppe besondere Aufmerksamkeit und großes Lob genossen. Zu dieser Gruppe wollte auch sie gehören und so reduzierte sie ihre Kalorienzufuhr drastisch, sodass sie irgendwann nur noch Salat und Eiswürfel aß. Meine mittlere Schwester und ich verdrehten anfangs nur die Augen, wenn sie am Mittagstisch wieder einmal behauptete, dass sie kein Hunger habe, weil sie ja schon in der Schule gegessen habe. Irgendwann wurden wir dann aber sauer auf meine Mama, die solche Ausreden durchgehen ließ und lieber uns die übrig gebliebene Portion aufdrängte, als meine kleinste Schwester darum zu beten, wenigstens zu probieren. Auch erlaubte meine Mutter meiner Schwester mittlerweile, an fünf Tagen die Woche in die Tanzschule zu gehen und am Tag zwischen einer und drei Stunden am Unterricht teilzunehmen. Esstörungen waren zwar nichts Neues in unserem kleinen Wohnort, jedoch etwas sehr Seltenes und damit unverständlich. So wurde ich oftmals verständnislos und anklagend von Mitschüler*innen und Lehrer*innen gefragt, was denn mit meiner kleinsten Schwester los sei. Auch meine Mutter wurde regelmäßig von Lehrer*innen kontaktiert und gefragt, was denn zu Hause los sei und ob meine Schwester überhaupt essen würde. Solche Vorwürfe machen es der ganzen Familie nicht einfacher. Aber die Menschen suchen nunmal nach Schuldigen. Das Lehrpersonal jedenfalls wollte sie nicht mehr am Sportunterricht teilnehmen lassen – das Risiko war ihnen schlichtweg zu groß, die körperliche Anstrengung zu arg. Meine Mutter ging daraufhin zu einem Arzt und ließ sich von diesem bestätigen, dass meine Schwester zwar sehr dünn sei, sie jedoch am Sportunterricht teilnehmen könne. Zur Schulpsychologin wurde meine Schwester und meine Mama ebenfalls gebeten, aber auch hier wiesen beide den Verdacht auf eine Essstörung vehement ab. Vielleicht, weil das das Schwerste ist: Sich selbst einzugestehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Nach einem halben Jahr wog meine Schwester 42 kg auf 1,70m und war zu schwach, um weiterhin so intensiv zu tanzen. Dann, ganz plötzlich, begann sie wie von selbst wieder mehr zu essen. Sie aß zwar zu den Hauptmahlzeiten weiterhin wenig, jedoch stopfte sie sich vor den Tanzstunden Schokoladenriegel rein, um die Stunden durchzuhalten. Sechs Jahre später ist meine Schwester immer noch sehr dünn und unglaublich tanzbegeistert, isst aber mittlerweile einigermaßen normal. Das ist ein großes Glück und nicht selbstverständlich. Sie kann heute über diese Zeit reden und gibt an, dass der Diätwahn von Bekannten oder in den Medien sie zum Teil triggert und sie sich dann selbst dabei ertappt, in alte Denk- und Verhaltensmuster zurückzufallen. Wir sollten also immer ganz genau darauf achten, was wir selbst konsumieren oder wen wir bewundern – aber auch, wie wir mit anderen über Dinge wie Diäten, Schönheit oder Körperideale sprechen. Einige sind stark genug, sich alldem zu widersetzen, viele aber eben nicht. Deshalb würde ich mir von Menschen und Magazinen viel mehr Sensibilität im Umgang mit solchen Themen wünschen. Und: Achtung, auch Komplimente für verlorenes Gewicht können Folgen haben, von denen viele nicht zu träumen wagen. Im schlimmsten Fall sind die anfänglichen Schmeicheleien nämlich Schmieröl für eine anfangende Essstörung.
Anna, 18 aus Leipzig
Mit 16 Jahren hatte ich mit einer mittelschweren Depression zu kämpfen. In meinem Freundeskreis hatte ich wenig Unterstützung, da vielen das Verständnis & die Erfahrung fehlten. In diesem Zeitraum fand ich langsam neue Freunde & auch einen besonders guten Freund. Ben & ich verstanden uns sehr gut, & konnten auch gut über unsere mentalen Probleme reden. Mit der Zeit ging es ihm immer schlechter. Er begann ebenfalls sich zu verletzen, schwänzte immer häufiger die Schule & äußerte den Gedanken sich das Leben zu nehmen. Für mich war das schwer mit anzusehen, wenn ein lieber Mensch so den Lebensmut verliert. Für Ben war ich oft der einzige Halt im Leben, was er mir auch immer wieder sagte. Das ehrte mich zwar, übte aber auch unfassbaren Druck auf mich aus. Jetzt musste ich nicht nur mich selber, sondern noch einen ganzen Menschen zusätzlich tragen. Ich telefonierte ständig mit ihm, ging später ins Bett, lernte weniger, & musste ständig erreichbar sein. Seinen Höhepunkt fand das ganze, als Ben mir eine Nachricht schickte, die man als Abschiedbrief interpretieren konnte, & sich daraufhin niemand meldete. Keiner wusste wo er war. Ich verließ sogar unerlaubt die Schule, um ihn zu suchen. Es stellte sich heraus, dass er nur verschlafen hatte. Seine Eltern, Freunde, Geschwister & vor allem ich waren stundenlang überzeugt dass Ben sich etwas getan hatte. Ab da rieten mir meine Freunde immer häufiger Abstand von ihm zu nehmen, aber das tat ich vorerst nicht. Ich fühlte mich verantwortlich. Unsere Freundschaft wurde immer toxischer, als er sich vor seinen falschen Freunden über mich lustig machte, mich zynisch abwies, nur um im nächsten Moment wieder weinend vor mir zu stehen. Es war ein krasser Wechsel aus „ich bring mich eh um, was willst du tun?“ & „du bist alles was mir bleibt“. Ben nahm mein Leben immer mehr ein & ich begann mich selbst zu vernachlässigen. Irgendwann schaffte ich den Sprung aus dieser toxischen Beziehung und brach den Kontakt ab. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist für Freunde da zu sein. Aber wenn dieses Verhältnis unausgeglichen ist, nicht auf Gegenseitigkeit beruht und anfängt das eigene Leben nachhaltig negativ zu beeinflussen, man ständig in Schuldgefühlen badet: Cut. that. toxic. shit. out. of. your. Life! Das hat nichts damit zu tun dass ihr jemandem im Stich lasst, sondern dass ihr euch selbst nicht im Stich lasst. Passt auf euch auf!
Laura, 27 aus Berlin
Wenn ich an meine Freundinnen denke, dann überfällt mich oft ein Freudenschauer am ganzen Körper. Ich denke dann daran, wie klug und stark jede einzelne ist und auch wie unterschiedlich sie alle sind. Sie sind meine Patroni, meine Schutzschilder, meine Lichtbringer. Wir alle sind das, an unterschiedlichen Punkten, füreinander und miteinander. Wir können die stummen Rufe hören. Internet 2.0 macht es möglich, dass ich auch mit jenen, die hunderte Kilometer von mir entfernt wohnen, trotzdem eine Nähe spüre, wenn ich nachts um 2 eine 20-minütige Sprachnachricht anhöre und mit der Stimme einer Freundin zu Bett gehe. Wie geht es dir? Wie hast du geschlafen? Das sind ganz alltägliche Fragen, die wir uns gegenseitig stellen. Deine Stimme klingt voller Energie, du hörst dich glücklich an. Ich habe lange daran gearbeitet, mich und meine Gefühle lesen und das Handeln und Denken von anderen Menschen verstehen zu können. Eine Psychotherapie hat mich dabei fast 7 Jahre lang unterstützt. Irgendwann habe ich gelernt, dass ich mich mit derselben Wärme und bedingungslosen Liebe annehmen muss – oder viel besser: kann – die ich auch für die Menschen in meinem Leben fühle. Auch die ein oder andere Freundin von mir geht derzeit in Therapie und ich bin der festen Überzeugung, dass jede*r eine machen sollte, wenn man schon mal darüber nachgedacht hat. Es liegt soviel Stärke darin sich seinen schlimmsten Ängsten zu stellen und am Schluss auch die eigenen Schwächen akzeptieren zu können.
Mit dem inneren Wandel veränderte sich auch mein Umfeld: ich begann damit, all meine Beziehungen unter die Lupe zu nehmen und fragte mich: Wie lässt mich dieser Mensch fühlen? Fühlte ich mich unbehaglich oder unruhig, unsicher oder klein, dann fragte ich: Was mag ich an ihm*ihr? Fiel mir darauf nicht direkt eine Antwort ein, dann wusste ich, dass es an der Zeit ist etwas zu ändern. Denn Freundschaften, zu denen wird man nicht gezwungen, die führt man freiwillig. Also muss ich auch nicht passiv sein; ich kann entscheiden. Und ich entschied mich. Für Empathie, Wertschätzung, Solidarität, Ehrlichkeit, (gewaltfreie) Kommunikation, Nähe, Geborgenheit, Transparenz. Und gegen Konkurrenzdenken, Beleidigungen, Egozentrik, Missgunst, Intriganz, Heimlichtuerei. Es gibt Dinge, für die habe ich, für die mache ich einfach keinen Platz in meinem Leben. Wir alle, ich und meine Freundinnen, wir sind Feministinnen. Und auch der Feminismus hat uns, wie die Psychotherapie, empowernde Strategien bereitgestellt, die wir nutzen: Wie kann ich Stärke in mir finden? An welcher Stelle scheine ich mir schwach, besitze aber eigentlich viel Stärke und Mut? Welche sind meine Stärken? Wie kann ich mich aus einer Situation oder Beziehung emanzipieren? Wie kann ich das, was mir passiert ist, umkehren und vielleicht sogar diese Erfahrung als Gewinn sehen? Wie kann ich in einer Konfliktsituation gewaltfrei, konstruktiv, wertschätzend und produktiv kommunizieren, selbst wenn mein Gegenüber das nicht mal tut? Dafür ist es unbedingt nötig, dass wir uns trauen einander den Spiegel vorhalten und ihn nicht wegnehmen, auch wenn es manchmal unangenehm ist hineinzuschauen. Denn es gibt wirklich nichts Schöneres als einander wachsen zu sehen, jede*r im eigenen Tempo.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Anna, 24 aus Augsburg
Nach einer schlimmen Trennung im Jahr 2016 rutschte ich in eine schwere, depressive Episode. Nichts konnte mich von meinem Schmerz befreien, Partys und viel Alkohol waren nur weitere Dämpfer meiner Gefühlswelt. Gefangen in einem Zustand der Lethargie und toxischen Verhaltensweisen wie Selbstverletzung waren meine Freunde sehr oft überfordert mit mir und meinem Kummer. Die meisten konnten nicht nachvollziehen, wieso es mir nach einer Trennung, die ICH wollte, so schlecht ging. Auch damals gab es jedoch zwei Freundinnen, die das Wort Therapie als Lösungsansatz in den Raum warfen. Da ich zwei Jahre vor der Trennung bereits eine Verhaltenstherapie angefangen, aber wieder abgebrochen hatte, war ich eher skeptisch gegenüber dem Thema eingestellt. Außerdem konnte ich den komplizierten und langwierigen Weg zur Therapieplatzsuche nicht bestreiten. Zu anstrengend, zu enttäuschend, zu viel Aufwand. Eine Arbeitskollegin gab mir ca. ein Jahr später schließlich den Anstoß, indem sie mir den Kontakt zu ihrer eigenen Therapeutin herstellte. Die Offenheit über ihre mentale Gesundheit, mit der mir meine Kollegin damals gegenüber trat, machte mir Mut. Ich wusste: ich bin nicht allein und ich konnte sehen, dass eine Therapie helfen kann. Seit September 2017 begleitet mich eine Psychoanalytikerin auf meiner Road to Recovery. In meinem Freundeskreis wissen alle, dass ich eine Therapie mache. Es gibt hierunter einige, die selbst schon Erfahrungen damit gesammelt hatten, andere können mit der Thematik eher wenig anfangen. Ich selbst versuche, sehr offen über das Thema Mental Health zu sprechen. Die Erfahrungen, die ich dabei mache, sind sehr unterschiedlich. Zum einen bin ich mittlerweile sehr sensibel, was die Verhaltens- und Denkweisen meiner Freunde betrifft. Ehrlich gesagt ist es manchmal auch ein bisschen frustrierend, da ich mir bei einigen wünschen würde, sie würden ebenfalls den Schritt wagen eine Therapie aufzusuchen. Einfach, weil ich mir wünschen würde, dass es ihnen besser geht. Viele meiner Freunde stehen gerade, wie ich, an der Schwelle vom Studium ins Berufsleben. Das wirbelt vieles auf, die Suche nach dem eigenen ich beginnt irgendwie wieder von vorne, da man sich jahrelang als StudentIn identifiziert hat. Genau da muss ich allerdings auch manchmal einen Gang zurückschalten. Generell bin ich aufmerksamer geworden. Als hochsensible und empathische Person ist es sowieso schwierig, sich von anderen und deren Gefühlen abzugrenzen. Mit dem Hintergrundwissen aus meiner Therapie ist das noch ein Stückchen schwieriger geworden. Gleichzeitig lerne ich aber genau das in meinen Sitzungen: mich abzugrenzen und nicht die Verantwortung für andere Menschen übernehmen zu wollen. Wichtig ist für mich, einen Mittelweg zu finden. Ich versuche, zu unterstützen und zu reflektieren, wo es gewünscht ist. Aber ich weiß auch, dass ich nicht das Recht und auch nicht die Pflicht habe, mich „einzumischen“. Ich versuche, das Thema Mental Health so anzusprechen, dass man keine Angst mehr vor diesem Begriff und allem, was damit verbunden ist, hat. Im Idealfall rege ich damit zur Selbstreflexion an und helfe gegen Stigmatisierung anzukämpfen. Für mich selber ist es auf jeden Fall so, dass ich viel besser kommunizieren kann wie es mir geht und auch keine Angst mehr davor habe mal zu sagen: es geht mir nicht gut. Oft wird ja gerade am Wochenende erwartet, dass man einfach gut drauf ist und Party machen kann. Es ist schön, nicht mehr unter diesem Druck zu stehen und auch anderen das Gefühl zu geben, es muss nicht immer alles rosarot sein.