Sich als Schwarz zu identifizieren, ist ein langer Ritt gewesen. Für mich. Dabei mangelt es nicht an Literatur über Rassismus und auch lesenswerte Bücher über das Schwarz sein in Deutschland gibt es inzwischen. Ich habe sie gelesen. Aber für mich war es dennoch schwer. Ein Prozess. Zu kapieren, wer ich bin. Weil das Haar zwar lockig und dunkel ist, die Hautfarbe aber stets heller scheint als die der weißen Mutter, ja, oft sogar blasser als die der weißen Freundinnen. Außer vielleicht im Sommer. Wenn das Umfeld dazu neigt, einem aufgrund optischer Merkmale Identitäten anzudichten, sie einem aufzwingt oder gar abspricht, sorgt dies zusätzlich für Verwirrung und Irritation. Schwarz – das Wort klingt nach tatsächlicher Farbe, nach Eindeutigkeit. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass viele Menschen sich nicht trauen, es zu benutzen. Zu unrecht. Man darf es benutzen! Man sollte sogar.
Das gesellschaftliche Konstrukt von Schwarz sein, heute oft von „of Colour“ sein ersetzt, beschreibt ein von Rassismus geprägtes gesellschaftliches Stigma. Eines, welches sich dadurch auszeichnet, dass die Hautfarbe, die Herkunft oder die Identität eben niemals egal war, immer im Mittelpunkt stand oder besprochen wurde. Schwarz sein, das heißt auch, dass Rassismus in der eigenen Lebenswelt stattfindet, zu einem gehört. Aber Moment. Schwarz ist nicht gleich Schwarz, oder? Der Fairness halber muss man sagen: Ja. Denn mein Schwarz sein ist nicht das gleiche wie das Schwarz sein von Barack Obama, auch nicht das von Motsi Mabuse oder Lupita Niyong’o.
„Colourism is the prejudicial or preferential treatment of same-race people based solely on their colour“– Alice Walker
|
Und da wären wir auch schon bei Colourism angelegt. Ein Konstrukt, welches die Abwertung von Menschen aufgrund der Ausprägung ihres Phänotypes beschreibt. Ja, ganz richtig. Und zwar innerhalb einer von Rassismus betroffenen Gruppe.
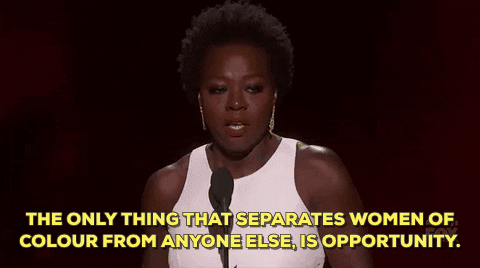
Manch einer benutzt für die Beschreibung von unterschiedlichen Hautfarben etwa Begriffe wie Karamell oder Latte Macchiato – sie lassen schließlich positive Konnotationen erahnen. Das unbekannte Fremde wird dadurch greifbarer, wirkt vielleicht nur halb fremd, halb exotisch. Ist doch schließlich schön und toll, „mixed“ sein. Bloß bin ich, sind wir, nunmal keine Lebensmittel. Eine braune Haut, ein heller Beigeton zum Beispiel, scheint für Menschen begehrenswert zu sein, erinnert er doch an den Sommerurlaub. Und vielleicht liegt genau in diesem Missverständnis die Krux begraben: Diese Haut ist nämlich nicht ge-bräunt. Sie ist angeboren. Sie geht mit Benachteiligungen einher. Die dadurch erzeugte Konfrontation mit Rassismus und Diskriminierung is für Außenstehende bei Menschen mit hellerem Phänotyp jedoch vermeintlich weniger offensichtlich, gar versteckt, weil glänzende Locken und gebräunte Haut doch „etwas so Schönes sind“.
Reden wir hingegen über dunkle Phänotypen, sieht es schon ganz anders aus. In einer weißen Mehrheitsgesellschaft erscheint die sehr dunkle Haut fremder, der Rassismus- oder Diskriminierungsaspekt ist viel deutlicher erkennbar. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen: Ich hätte auch gern so eine Haut! Oder so ein süßes Schoko-Kind! Sich die Hautfarbe der anderen herbei zu wünschen? Naja. Schräg ist das, wenn man den Kontext bedenkt. All die europäisch-weißen Schönheitsideale und die europäisch-weiß dominierte Medienlandschaft. Exotismus? Klar, voll sexy, niedlich oder was auch immer. Aber bitte nur in Maaßen. Halb halb eben. Das geht! Alles andere: Besser nicht.

Alek Wek wirft aus Protest gegen europäische Schönheitsideale ihre Perücke auf einer Betsy Johnson Fashion Show 1998
Kolorismus oder auch Colourism beschreibt ein Stigma, welches als solches erstmals in den USA explizit benannt wurde und seinen Ursprung unter anderem im aufkommenden Rassismus des 18. Jahrhunderts und in der US amerikanischen Sklaverei des 19. Jahrhunderts hat. Menschen mit hellem Phänotyp waren hier für Arbeiten rund ums Haus vorgesehen. Sie galten als vorzeigbar, ihre Haare als besser zu bändigen, Kinder aus „Interracial“ Beziehungen entsprachen einem weißeren Schönheitsideal und hatten „weißere“, „amerikanischere“ Gesichtszüge. Dunklere Phänotypen waren für niedere Arbeiten bestimmt. Sie galten als ungezähmter und charakterlich wilder, ja afrikanischer. Und heute? Heute lassen sich viele dieser Muster wiederfinden in der Art und Weise, wie BPOC rezipiert und gesellschaftlich eingeordnet werden. Das internationale Problem ist zudem im Kern dem indischen Kastenwesen zuzuschreiben. Auch viele ostasiatische Länder fahren einen „Skin-lightener“ Kult und begehren nach möglichst heller Haut.
Mein Rassismus ist real, jedoch oft geprägt von appriciation meiner optichen „Exotik“ in light Version. Und wir reden hier auch über „Becky with the good hair“ und all die Fehden zwischen Frauen, die in einer Gesellschaft groß geworden sind, die ihnen weismachen will, dass ihre Haare nur wirklich gut aussehen, wenn sie glatt und seidig, ja möglichst „weiß“ daher kommen. Je größer die Locken, je sanfter, desto besser. „Light-skinned-girls“, ohnehin ein riesiges Thema in der gesamten Unterhaltungsindustrie, von Hip-Hop bis Film wenn es um Inklusion von BPOC geht. Ich frage mich daher: Wo sind die richtig dunklen Hauttöne und warum macht es den Eindruck, als würden sie auf der Bildfläche quasi nicht stattfinden? Weil sie es nicht tun!
Für viele Menschen ist es alltäglich aufgrund ihrer Hautfarbe innerhalb ihrer „Ethnie“ abgewertet zu werden, nicht dazuzugehören. Ich persönlich finde zum Beispiel immer den Make Up Ton sand-beige im Drogeriemarkt, aber das kann sicherlich nicht jede Woman Of Colour von sich behaupten. Was ich aus diesem Umstand mitnehme, ist die scheinbare Erkenntnis, dass ich, so wie ich aussehe, noch irgendwie „vorzeigbar“ bin. Frauen, die wie ich „mixed“ sind, „halfcast“ oder „halbschwarz“, sind mittlerweile schon aufgrund der unausgesprochenen Quote in Werbungen oder Hollywoodproduktionen zu sehen – entsprechen sie doch einem eher westlichen Schönheitsideal, mit dieser leicht gebräunter Haut, die durch eine Prise Afrika verfeinert wird. Bravo.

Ja, es gibt sie. Privilegien innerhalb einer marginalisierten Gruppe. Ich weiß das schon lange. Und ich bin mir meiner eigenen bewusst. Weil ich aufgrund meiner Exotik-light schon Jobs bekam, aber auch männliche Aufmerksamkeit und viele Komplimente. Gleichzeitig wird meine deutsch sein nicht selten hinterfragt, ähnlich wie meine Bildung oder mein Wissen. Das sind die Dinge, die ich mit BPOC teile, die mich mit Diskriminierung konfrontieren. Aber es sind eben auch Dinge, oder besser Eigenschaften, die mir auch oft genug einen Vorsprung verschafft haben. Warum das dennoch alles Rassismus ist? Weil ich stets einkalkulieren muss, dass meine Hautfarbe und meine Wurzeln eine Rolle gespielt haben und weiterhin spielen – egal in welchem Kontext, ob bei der Arbeit, in der Uni, oder vor der Clubtür.
Die Tatsache, dass ich überhaupt die Energie und die Kapazitäten dazu aufbringe, mein Handeln und meine Rolle oder die gelebten Stigmata zu hinterfragen, sie zu bekämpfen oder mich diesbezüglich weiterzubilden, spielt bei alldem natürlich auch eine Rolle. Für von Rassismus betroffene Menschen ist das nämlich keine Selbstverständlichkeit. Es ist immer auch ein großer und vielleicht schmerzhafter Kraftakt, und wenn man so will, gerade deshalb ein weiteres Privileg meinerseits. Ich bin also gewillt, auch weiterhin ebenjene Privilegien, meine eigenen Vorteile, zu hinterfragen und zu begreifen, immerzu. Ich muss sogar, es ist meine Pflicht.
Tu doch das Gleiche. Und zwing nicht meine Schwarzen Schwestern dazu, es für dich zu tun. Das ist übrigens auch so ein Thema: Warum müssen POC überhaupt so vehement für ihre Rechte kämpfen? Wäre das nicht eigentlich vielmehr Aufgabe der weißen Gesellschaft?


