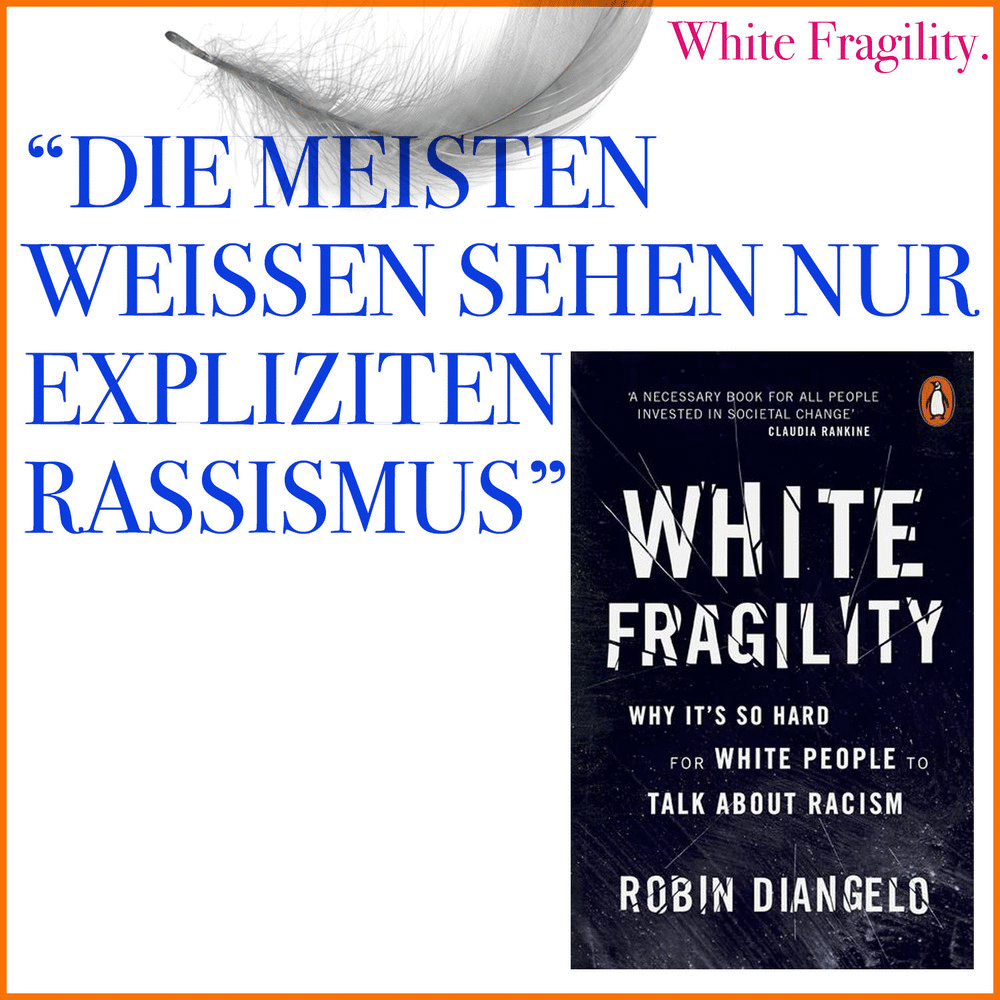Speaking to the Choir, ein Phänomen, was mich hier auf This is Jane Wayne, jedoch auch in meiner Instagram-Realität verfolgt. Der Backflash auf gesellschaftskritischen Content bleibt aus oder beläuft sich auf ein Minimum, weil die Filterbubble vorher schon alle Kritiker*innen ausgesiebt hat, dafür sorgt, dass sich der Content innerhalb gewisser Strukturen spiegelt, bejubelt und geteilt wird. In ganz seltenen Fällen ist das nicht der Fall – zum Glück.
Zum Glück werden ich und viele andere politisch aktive Menschen damit konfrontiert, dass unsere Arbeit hier noch nicht getan ist, wir noch lange nicht am Ziel sind und die Agenda länger scheint als je zuvor. Menschen werden richtig wütend, wenn man Gefahr läuft, die Fassaden ihres linken Selbstverständnisses einzureißen. Wenn es darum geht, dass selbst sie, die braven Bündnis 90 Wähler*innen aus Kreuzberg, auf Du mit allen syrischen Restaurants auf der Sonnenallee und seit dem Abi feministisch aktiv, unbedarft und ungewollt internalisierten Rassismus in die Welt tragen, ohne sich selbst und die rassistische Sozialisation je hinterfragt zu haben. „Kann nicht sein – ich und rassistisch?“ Dann geht es zu weit, dann fliegen die Fetzen, dann will man von dem „radikalen“, „extremistischen“ Blabla über kulturelle Aneignung und Co. nichts mehr wissen. White People’s Tears. Weiße Fragilität. Wenn weißen Menschen antirassistische Arbeit einfach irgendwann zu weit geht.
White Fragility – weiße Fragilität ist ein Status, in dem schon geringe Auseinandersetzungen mit *race oder eigenen Privilegien für weiße Menschen nicht zu ertragen sind. Zuschreibungen auf der Basis von rassistischer Sozialisation können dabei stark triggern, werden defensiv abgeblockt, relativiert und emotionalisiert. Menschen reagieren oft wütend aber auch ängstlich oder schuldig, sind geneigt, die Situation zu verlassen oder entziehen sich verbal der Konversation, weil es so unangenehm, ja quasi unerträglich ist. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Hautfarbe und race im Allgemeinen besteht darin, dass Weißsein als Dynamik, als quasi zugeschriebene Lebensrealität zu verstehen, in welcher weiße Menschen übergeordnet handeln, entscheiden, agieren und reagieren. Es muss mit der Prämisse starten, dass Rassismus und weiße Privilegien sowohl traditionelle als auch moderne Lebensrealitäten sind, die es aufzudecken und aufzuzeigen gilt. |
Rassismus, dass projiziert bei so vielen noch immer das Bild vom Altnazi aus Lichtenberg oder dem Fascho mit Glatze. Auch nach zwei Jahren Black Girls Confessions. Auch nach etlichen Erklärungen über subtilen Rassismus. Rassismus ist keine Tradition, kein Phänomen. Wir reden über gesellschaftliche Machtstrukturen, die systematisch den Status, den Wert von BPoC gegenüber weißen Menschen unterdrücken. In einer Welt, deren Säulen auf den Prinzipien alter, weißer Männer begründet wurden, denen 2019 noch immer Bücher gewidmet werden. In einer Welt, in der das Leben **Schwarzer Menschen weniger schützenswert ist, weniger relevant. Rassismus: Das, was uns dazu bringt, Schwarze gerne prinzipiell auf Englisch anzusprechen. Der Grundstein davon auszugehen, dass muslimische Frauen nicht selbstbestimmt leben und entscheiden. Die Basis von Fetischisierung und Stigmatisierung von nicht-weißen Kulturgütern. Die Kinderbücher, die wir alle einst lasen, die Nachrichten jeden Abend um 20.00 Uhr im Öffentlich Rechtlichen.
Das System ist zerfressen von rassistischen Grundstrukturen und wir merken es nicht, weil wir zu viele Reportagen schauen über die A-88 und das Nazidorf Jameln.
Wenn Schwarze Menschen über Rassismus reden tut das weh. Das tut weh, weil der linke alt 68er-Haushalt, auf den man glaubte zurückzublicken, auf einmal problematisiert wird, weil die Rastas des besten Freundes in der Kritik stehen, weil es bedeutet, selbst nicht immer alles richtig gemacht zu haben. Weiße Menschen tun sich schwer, ihre rassistische Sozialisation zu hinterfragen. Erstens, weil sie es nicht gewohnt sind, mit diesem Thema konfrontiert zu werden („Die Nazis sind schuld, ich wähle links“), zweitens, weil das Thema unangenehmer nicht sein könnte, weil es mit dem Finger auf heute zeigt und auf Dinge und auf Praktiken, vielleicht sogar auf den eigenen Lebenslauf samt dem Auslandsjahr in einem sri-lankischen Kinderheim. Wenn es doch nur die expliziten Momente wären, die Unbehagen bereiten. Wenn es nur dann schmerzte, wenn Rassismus outgecallt und thematisiert werden würden.
Mensch stelle sich vor, Rassismus wäre für einen allgegenwärtig, ja gefährlich oder bedrohlich auf den Straßen seiner Heimatstadt. Undenkbar für die einen und gleichzeitig Lebensrealität für so viele deutsche Menschen. „Der rassistische Status Quo ist der aktuelle Zustand, in dem es normal für people of color ist, überall Rassismus zu erleben.“ Sagt Soziologin Robin DiAngelo im Interview mit Hannes Schneider für Zeit Campus 2017. „Meistens, wenn Weiße über Rassismus sprechen, herrscht die Idee vor, dass Rassisten böse Individuen sind, die absichtlich und bewusst andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft verletzen wollen. Deshalb sehen Weiße meist nur expliziten Rassismus: Sie müssten das N-Wort sagen, bevor viele Weiße Sie als Rassisten sehen würden.“
Weiße müssen unbequem werden, um ihren rassistischen Background, unsere Gesellschaft, die auf Rassismen aufbaut und fortbesteht, zu verstehen. Erst dann sind sie in der Lage, die Welt für von Rassismus und Diskriminierung betroffenen Menschen zu einer besseren zu machen. Ersteres kann bedeuten, dass man sich selbst als langjährigen Ignoranten entpuppt, dass man bei Texten wie diesen sauer wird und bockig und sich schuldig fühlt, dass es schwerfällt, sich auf eine Sprache einzulassen, die kategorisiert und trennt zwischen Schwarz und Weiß. Dass es genau das braucht, um Privilegien und Missstände in unserer Gesellschaft verstehen zu können. Rassismus, das ist ein Thema, das bis zum bitteren Ende unangenehm bleibt. Unbequem und hässlich und unglaublich wichtig obendrein.
|
Das ganze Interview von Robin DiAngelo und Hannes Schrader gibt es hier!Den Essay von Robin DiAngelo über White Fragility gibt es hier! |