Ich und viele andere sind sich aktuell uneinig: Wird dieses Jahr das längste oder das kürzeste, was wir in unserem Leben bislang erleben durften? Kaum in den August gerutscht, denke ich daran, wie ich noch im März auf dem Balkon beobachtet habe, wie sich die Bäume auf dem Hof an ein sehr schüchternes Hellgrün heranwagten um gefühlt schon bald darauf in sattem Glanz zu ergrünen. Was ich sagen will: Ich kann mich nur noch wage daran erinnern, wie es war, als diese Beobachtungen aus dem Fenster beinahe meine einzigen Berührungspunkte zum tatsächlichen Weltgeschehen abseits von Tagesschau und Instagram dargestellt haben. Aber ausgerechnet jetzt, wo ich festsitze in einem Sommer voller Termine, Verpflichtungen und Tatendrang, wünsche ich mir kaum etwas sehnlicher herbei, als endlich wieder genügend Zeit und Ruhe zu haben, um überhaupt aus dem Fenster zu starren.
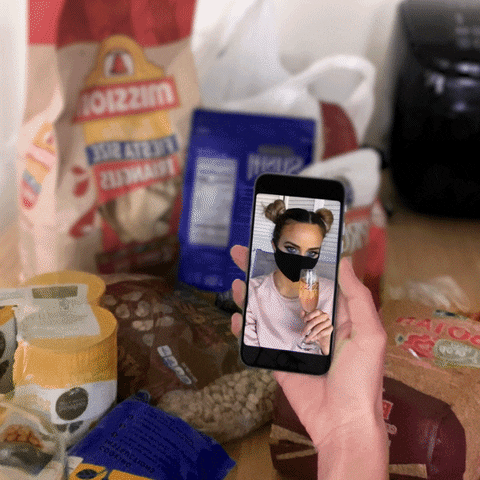
Hier und anderswo wurden Privilegien dargelegt und verhandelt. Wichtig und richtig an dieser Stelle. Zu jenen zu gehören, die an den Schreibtisch gefesselt waren, aber vor allem noch immer ein halbwegs stabiles Einkommen und sichere Lebensumstände ihr Eigen nennen konnten, hat auch mich in den vergangenen Monaten extrem geprägt und beschäftigt. Fast so sehr eben wie die Tatsache, dass alles was seit dem Shut Down in Richtung Normalität geht, mein Gemüt und meinen Geist, ja mein ganzes Dasein zu überfordern scheint. Es ist, als hätte mir nichts besser getan, als jegliche soziale Interaktion bis auf Weiteres auf Online-Welten zu beschränken. Mein Haus auch bei Sonnenschein nur im Notfall zu verlassen – und dabei sicher sein zu können, dass die Uhren in anderen Mietwohnungen wohl ähnlich zu ticken scheinen.
Dankbar war ich auch für die klaren Regeln und die Tagesstruktur, die sich angefühlt hat wie eine verrückte Form von Betriebsurlaub. Wer kennt dieses Gefühl, angespannt auf dem Weg in die Heimat zu sein, wohlwissend, dass sich während des kleines Urlaubstrips auf der Arbeit trotzdem alles weiter dreht und das Postfach mindestens 38756 Mails sammeln wird? Kurz hatte ich das Gefühl, dass mit einer verordneten Zwangspause, die für alle meine engsten Kontakte galt, vor allem die Sorgen um das Verpassen und das nicht Hinterherkommen so nichtig waren wie nie zuvor. Jomo (Joy of Missing Out) statt Fomo ( Fear of Missing Out).
Für viele sind die mit der Covid 19 Pandemie einhergehenden Einschränkungen und Leidensgeschichten noch längst nicht vorbei – oder sie beginnen gerade erst (wieder). Ich möchte an dieser Stelle aber dennoch darüber reden, was auch in Zukunft sicherlich nicht nur mir fehlen wird: Die Gewissheit, nichts zu verpassen und das amtliche verordnete Füße-Stillhalten. Ein gehöriger Mindestabstand zu denen, die wir auch schon vor den AHA Regeln eigentlich gar nicht umarmen wollten und und dann eben auch diese intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen – wie Ruhe, Entschleunigung und Selbstfürsorge.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
In meinem Kopf fliegen die Monate März, April und Mai auf einer ganz anderen Umlaufbahn als das Jetzt und werden schmerzlich vermisst. Das Gefühl von Scham über dieses Empfinden (wie kann ich nur?) paart sich dabei indes mit akuter Sommerüberforderung, plötzlich wieder aufkommender „Fear of Missing Out“ und einer schrägen Urlaubsreise, die ich in dieser Form noch nicht erlebt habe.
Trotzdem: anstatt eine Zeit zu vermissen, die für mich und so viele andere immer auch mit Entbehrungen und Verlust zutun hatte, wäre nun wohl der richtige Moment, innezuhalten. Und genau hinzusehen. Um sich vielleicht sogar noch viel ernsthafter mit den eigenen Kapazitäten und dem Setzen von beruflichen Grenzen auseinanderzusetzen. Für mehr innere Ruhe und Seelenfrieden sollte schließlich wirklich keine Ausgangssperre vonnöten sein.


