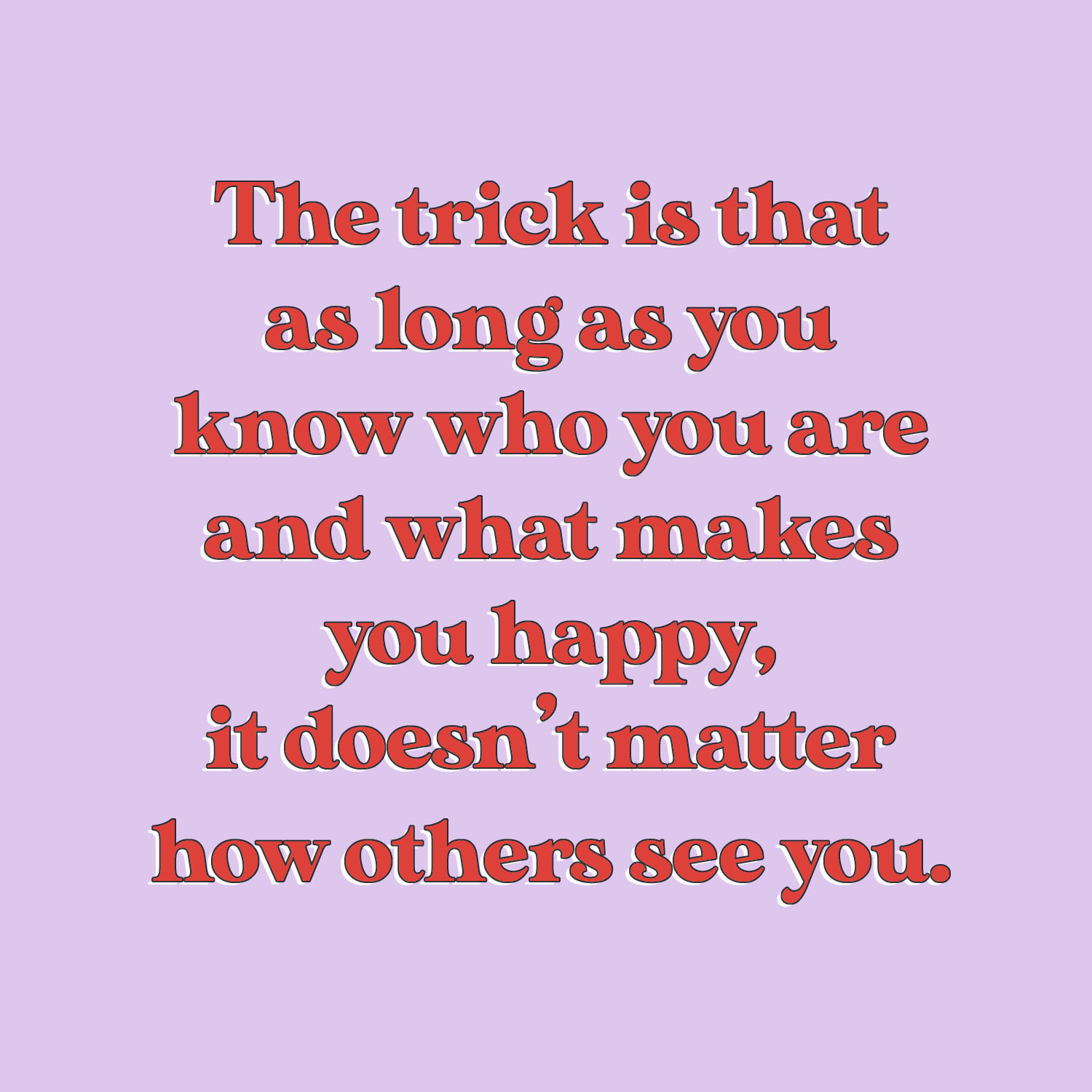Es ist irgendein Sommertag im Jahr 2013 und eigentlich ist es viel zu heiß, um sich in der glühenden Betonlandschaft der Innenstadt aufzuhalten. Überhaupt wäre ich in diesem Moment viel lieber zu Hause in meinem Bett, während die zugezogenen Vorhänge den leuchtend blauen Himmel abschirmen. Leuchtend blaue Himmel braucht doch sowieso niemand, denke ich da noch, und rücke meine Sonnenbrille zurecht, um die verheulten Augen zu verstecken. Trotz meines Verlangens, mich möglichst schnell auf den Nachhauseweg zu begeben, mache ich einen kleinen Zwischenstopp bei einem Café um die Ecke. Vielleicht, um meine Freundin, die in der vergangenen Stunde draußen auf mich gewartet hat, zu beruhigen, vielleicht aber auch, um mir selbst einzureden, dass mein Leben doch eigentlich stinknormal sei, ich diese Therapie mitsamt der Diagnosen also doch gar nicht brauche. Dass ich Dinge nicht brauche, rede ich mir ohnehin gerne ein, ganz besonders dann, wenn es um die Hilfe anderer geht. Immerhin, das weiß ich doch schon längst, wird das in unserer Gesellschaft nicht gerne gesehen und dann auch noch irgendwas mit der Psyche — das hat es doch früher gar nicht gegeben und überhaupt, was ist denn mit all den anderen Menschen, denen es viel schlechter geht? Stimmt. Warum glaube ich eigentlich, dass ich die Hilfe in irgendeiner Weise verdient habe?
Nun, streng genommen glaube ich das nicht einmal, vielmehr bin ich an einem Punkt, an dem ich nicht mehr so wirklich weiß, wohin mit mir, angelangt. Letztlich aber waren es aber natürlich mein Freund und meine Freundinnen, die mich gen Therapie stupsten und mir immer und immer wieder einbläuten, dass es mir damit besser gehen würde, weil — und das verstand dann auch ich irgendwann — weder sie noch ich mir selbst an dieser Stelle noch helfen konnten. Merkwürdig, wie leicht es einem doch fallen kann, anderen Menschen jegliche Hilfe, jegliches Glück, jegliche Gesundheit von Herzen zu gönnen, ja gar zu wünschen, während man die eigenen Probleme und Lasten, den eigenen Schmerz immer wieder kleinredet oder zuweilen gänzlich verleumdet, bis man beginnt, jene Lügen selbst zu glauben. Dabei ist es doch eigentlich gar nicht so schwer, rein theoretisch zumindest, denn natürlich wiegt der gesamte Prozess mindestens hundert Tonnen und wer möchte sich diesen schon gerne annehmen? Da wird ganz plötzlich ein einzelnes Telefonat zur größten Qual, E-Mails werden aufgeschoben, weil sich die Frage nach einem Therapieplatz verdächtig nach Bettelei anfühlt und die Angst vor einer Abfuhr noch viel größer ist, als sich einfach weiterhin der Essstörung, der Depression, den Stimmungsschwankungen, der eigenen Verzweiflung und Erschöpfung, die oftmals auch gar keine Bezeichnungen brauchen, hinzugeben.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ist man aber erst einmal angekommen, in den ersten Therapiesitzungen meine ich, fühlt es sich ganz plötzlich normal an, mit einer fremden Person über das eigene Leben, die eigenen Gedanken und Gefühle zu sprechen und dabei vielleicht sogar auch mal 50 Minuten am Stück Tränen zu vergießen, denn natürlich geht es auch den vielen anderen, die in jenen kleinen Räumen auf jenen stinknormalen Stühlen sitzen, ganz genauso — das verrät bereits ein Blick auf die bunte Taschentuchbox auf dem Beistelltisch. Die „anderen“, das sind Menschen wie ich, die draußen im Wartezimmer auf quadratischen Ledersesseln sitzen, während sie in Büchern lesen, durch Zeitschriften blättern oder auf ihren Handys tippen. Völlig normal eben, auch wenn uns die Medienindustrie gerne weismachen möchte, dass „irgendwas nicht mit ihnen stimme“, dass sie bestimmte Erkennungsmerkmale vereine, ja, manche von ihnen sogar „verrückt“ seien.
Ja, ich bin mir sicher, dass es dieses „Verrücktsein“ war, vor dem ich so lange Angst hatte, so sehr, dass ich völlig falsche Vorstellungen aufbaute und den Warteraum meiner ambulanten Psychiatrie beim ersten Mal so beschämt betrat, dass ich die Luft anhielt und es nicht wagte, den Blick vom Boden zu lösen, weil ich glaubte, alle anderen Patient*innen könnten mich verurteilen, sich Geschichten über mich ausmalen. Dass sie sich nicht sonderlich für mich interessierten und wohl schon längst verstanden hatten, dass Therapien völlig normal sind, begriff ich erst einige Monate nach jenem heißen Sommertag, als ich nicht nur eine Kommilitonin im Wartezimmer der Ambulanz traf, sondern auch zum ersten Mal keine Versuche unternahm, mein verheultes Gesicht zu verstecken. Es ist doch so: Eine Therapie ist nichts, wofür man sich je schämen sollte, vielmehr ist sie eine Chance, uns selbst und unsere Probleme zu verstehen, zu ergründen und im besten Fall etwas nachhaltig zu verändern und das, so will ich doch meinen, würde uns letztlich allen guttun.