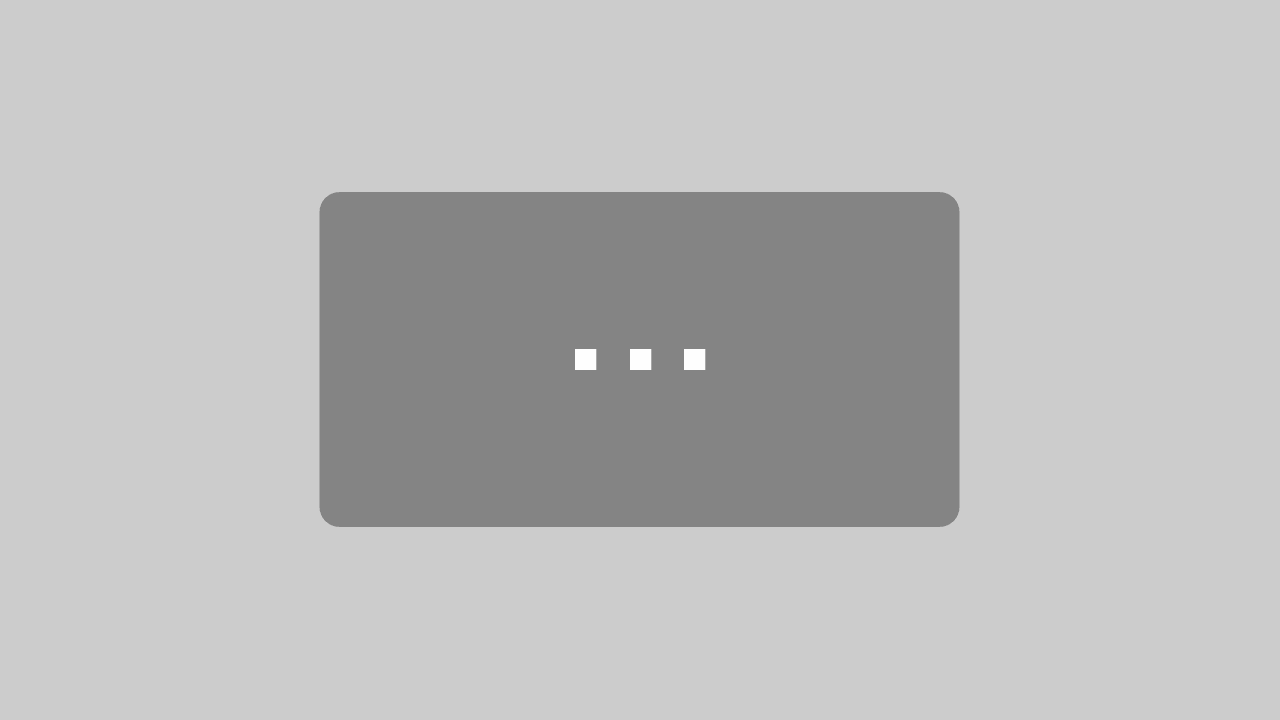Achtung, Spoiler! Was hatte ich mich auf Bridgerton gefreut: Der Trailer zur neuen Netflix-Serie – die auf der erfolgreichen gleichnamigen Buchreihe von Julia Quinn basiert – versprach einen Mix aus Jane Austen und Gossip Girl, aus historischem Setting und moderner Inszenierung. Mit Shonda Rhimes als Produzentin, so dachte ich, könne ja nicht viel schief gehen. Also begann ich kurz nach Weihnachten, die erste Folge zu schauen – in der festen Erwartung, sogleich in einen Binge-Watching-Rausch zu verfallen. Stattdessen… sah ich eine Folge und hatte dann erstmal genug. Nach ein paar Tagen schaute ich weiter, immer damit rechnend, dass sich das Rauschgefühl endlich einstellen würde. Aber: Nichts. Ich schaute alle acht Folgen, fand sie ästhetisch ansprechend und ganz okay und ja, irgendwie genau das Richtige für das Ende eines frustrierenden, schwierigen Jahres.
Mittlerweile haben Millionen Menschen weltweit Bridgerton gesehen, die Serie gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen. Mehr noch: Sie hat sich zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. Und warum auch nicht? Die Ausstattung ist opulent, die Kostüme schillernd, und die Darsteller*innen alle jung und attraktiv (oder, wenn nicht mehr jung, dann charismatisch und unterhaltsam). Zusammen mit den sexy Sex-Szenen und der von Julie Andrews gesprochenen anonymen Society-Klatschbase Lady Whistledown ergibt das Eskapismus in seiner schönsten Form. Und ich war absolut bereit, mich ihm hinzugeben. Doch letztendlich sind da schlicht zu viele Dinge, die Bridgerton für mich zu einer durchschnittlichen und nicht zu einer guten Serie machen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Langweilige Daphne
Das fängt schon bei den beiden wichtigsten Charakteren der ersten Staffel an: Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), die älteste Tochter der kinderreichen, adeligen Bridgerton-Familie, ist auf dem Londoner Heiratsmarkt des Jahres 1813 unterwegs, um einen passenden Ehemann zu finden. Sie gilt als Fang der Saison, aber sie hat ein Problem: Ihr ältester Bruder Anthony (Jonathan Bailey) nimmt seine Pflicht als Haushalts-Vorstand (Papa Bridgerton ist vor Jahren gestorben) sehr ernst und schlägt Daphnes Verehrer einen nach dem anderen in die Flucht. Keiner ist ihm gut genug für seine Schwester. Auftritt Simon Bassett (Regé-Jean Page), seines Zeichens Duke von Hastings, Frauenheld und ein alter Freund Anthonys. Er hat sich lange nicht mehr in London blicken lassen und stattdessen seine Zeit mit Reisen verbracht. Nun möchte ihn jede Mutter als Ehemann für ihre Tochter sichern. Weil Simon sich aus Rache an seinem tyrannischen Vater geschworen hat, nie zu heiraten und Kinder zu bekommen, entwickeln er und Daphne einen Plan: Simon soll so tun, als würde er ihr den Hof machen, damit er seinerseits von Schwiegermüttern in spe ihn in Ruhe gelassen wird und sie ihrerseits für potenzielle Verehrer begehrenswert scheint. Der Plan funktioniert und es kommt, wie es kommen muss: Daphne und Simon verlieben sich ernsthaft, können sich das aber aufgrund von Kindheitstraumata und Missverständnissen zunächst nicht eingestehen – selbst dann, als sie verheiratet sind. Die Frischvermählten haben jede Menge Sex und Simon, ganz aufgeklärter Gentleman, sorgt stets dafür, dass die sexuell völlig unerfahrene Daphne einen Orgasmus hat.
Das alles wäre berührend und sexy, wenn Daphne nicht so furchtbar langweilig wäre. Die einzigen Charaktereigenschaften, über die sie zu verfügen scheint, sind eine freundliche Art und der dringende Wunsch, eine eigene Familie zu gründen. Daphne ist schön, rein und alle mögen sie. Ihre Wünsche und Sehnsüchte sind mehr oder weniger deckungsgleich mit denen, die die damalige Gesellschaft ihr vorgibt – Daphne besteht einzig darauf, dass sie aus Liebe heiraten will, so wie ihre Eltern es getan haben. Simon hingegen swaggert durch jede seiner Szenen und hat so viel Charisma im kleinen Finger, wie Daphne nicht einmal in einer Spitze ihres akkurat frisierten Ponys. Was es schwierig macht, sich wirklich für diese Romanze zu erwärmen. Wie viel interessanter wäre es zum Beispiel gewesen, Simon mit Daphnes vorlauter und freigeistiger jüngerer Schwester Eloise (Claudia Jessie) zusammenzubringen oder mit Genevieve Lacroix (Kathryn Drysdale), der gefragtesten Schneiderin – sorry, ich meinte natürlich modiste – der Gegend. Doch Daphne ist nicht nur langweilig, sie ist auch problematisch: Eine (bereits in der Buchvorlage) umstrittene Sex-Szene zwischen ihr und Simon wirft Fragen nach dem sexuellen Konsens auf und danach, ob es sich hierbei nicht sogar um einen sexualisierten Übergriff durch Daphne handelt.
Ein alternatives Universum
Am meisten ärgert mich an Bridgerton sein verschenktes Potenzial. Und das zeigt sich nirgendwo deutlicher als an der Ausgestaltung der „alternativen Realität“, in der die Handlung angesiedelt ist. Diese Realität ist unter anderem bevölkert von einer Schwarzen Königin (Golda Rosheuvel) und zahlreichen Schwarzen Adeligen, die den weißen Adeligen in Ansehen und Reichtum in nichts nachstehen. In den ersten Folgen hat man als Zuschauer*in nur eine vage Ahnung davon, dass hier nicht einfach mit sogenanntem „colorblind casting“ gearbeitet wurde, die Schauspieler*innen also unabhängig von ihrer Hautfarbe gecastet und weiße Charaktere aus der Buchvorlage mit people of color besetzt wurden. In einem Flashback sieht man Simons Vater darüber sprechen (eher: schreien), dass die Familie den Titel noch nicht lange hat und deshalb alle Welt auf sie schaut, sprich, sie sich in besonderem Maße beweisen müssen. Weil sie Schwarz sind. Erst in der vierten Folge wird dann klar, auf welchen gesellschaftspolitischen Prämissen Bridgerton tatsächlich basiert: Simon spricht mit seiner Vertrauten und alten Familienfreundin, Lady Danbury (Adjoa Andoh), über das Dasein als Schwarze Adelige. Lady Danbury sagt: „Seht Euch die Königin an, seht Euch den König an, ihre Verbindung. Seht euch an, was sie alles tun, und zwar für uns. Was sie uns erlauben, zu werden. Wir waren zwei verschiedene Gesellschaften, die nach Hautfarbe getrennt waren, bis sich ein König in eine von uns verliebte.“ Simon ist pessimistischer und weist darauf hin, dass diese von einem Weißen gewährten Rechte ihnen auch wieder weggenommen werden können.
Ich hatte erwartet, dass diese Szene nur der Auftakt ist für eine Erkundung dessen, wie diese alternative Realität funktioniert, welche Rolle die Hautfarbe dort – trotz vorhandener Privilegien – spielt und was das alles für die Schwarzen Charaktere wie Simon, die Schneiderin Genevieve Lacroix oder die unverheiratet schwangere Marina Thompson (Ruby Barker) bedeutet. Stattdessen passiert: nichts. Es fühlt sich so an, als hätten die Serienmacher*innen mit der Szene zwischen Simon und Lady Danbury ihre Pflicht erfüllt, das Thema Hautfarbe und Rassismus zu thematisieren und könnten sich nun wieder auf die wirklich interessanten Geschichten konzentrieren: die Geschichten der weißen Charaktere. Denn abgesehen von Simon sind alle Schwarzen Charaktere Nebenfiguren. Im Zentrum der Serie stehen die weißen Charaktere, ihre Sorgen und Sehnsüchte.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Diversity als Feigenblatt
Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe: Wenn es laut Serien-Logik so ist, dass der König Schwarzen deshalb die Adelsrechte verliehen hat, weil seine Gemahlin selbst Schwarz ist (ob die historische Queen Charlotte Schwarz gewesen sein könnte wird seit längerem diskutiert) – wann genau ist das gewesen? Es kann noch nicht besonders lange her sein, denn Simon ist ein Kind, als sein Vater ihm predigt, dass ihre Familie sich besonders beweisen müsse, weil sie den Adelstitel erst seit dieser Generation haben. Das bedeutet, viele der älteren Bridgerton-Charaktere müssten sich noch an eine Zeit erinnern, als nur weiße Menschen über Feudalrechte verfügten. Und nur ein paar Jahre später ist es für sie völlig normal und gar kein Problem, dass nun auch ihre Schwarzen Mitbürger*innen dank eines verliebten Königs mit Adelstiteln und Vermögen ausgestattet wurden? Niemand von ihnen hat auch nur einen einzigen rassistischen Gedanken?
Das zu glauben erfordert einen riesigen Gedankensprung. Um es ganz klar zu sagen: Natürlich ist diversity wünschenswert und es ist erfrischend, ein London der Regency Era zu sehen, in der Schwarze Menschen endlich mal nicht auf die Rolle von Mägden oder Dienstboten festgelegt sind. Aber das allein reicht nicht: Wenn sie so oberflächlich umgesetzt wird wie in Bridgerton, ist diversity ein bloßes Feigenblatt. Denn solange Schwarze Charaktere als bloße Handlanger*innen für die Entwicklung der weißen Charaktere dienen und das Thema Rassismus in einer kurzen Szene abgehandelt wird, bleibt dann irgendwie doch alles beim Alten.
Am Ende ist Bridgerton deshalb so erfolgreich, weil die Serie genau das bietet, was sie verspricht: emotionalen Balsam für unsere coronawunden Seelen. Ein luftig-leichtes Soufflé, das auf der Zunge zergeht und dessen Geschmack sich schnell verflüchtigt. Wenn da nicht dieser bittere Nachgeschmack wäre. Und die Ahnung, dass die Serie mit ihren pompösen Kulissen und Kostümen geschickt davon ablenkt, wie hohl sie in ihrem Inneren tatsächlich ist.
Zum Weiterlesen: Die Wissenschaftlerin Kerry Sinanan diskutiert mit anderen Expert*innen, inwiefern Bridgertons alternatives Universum auf problematischen Mythen über race und gender basiert.
Startbild: Cr. LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020