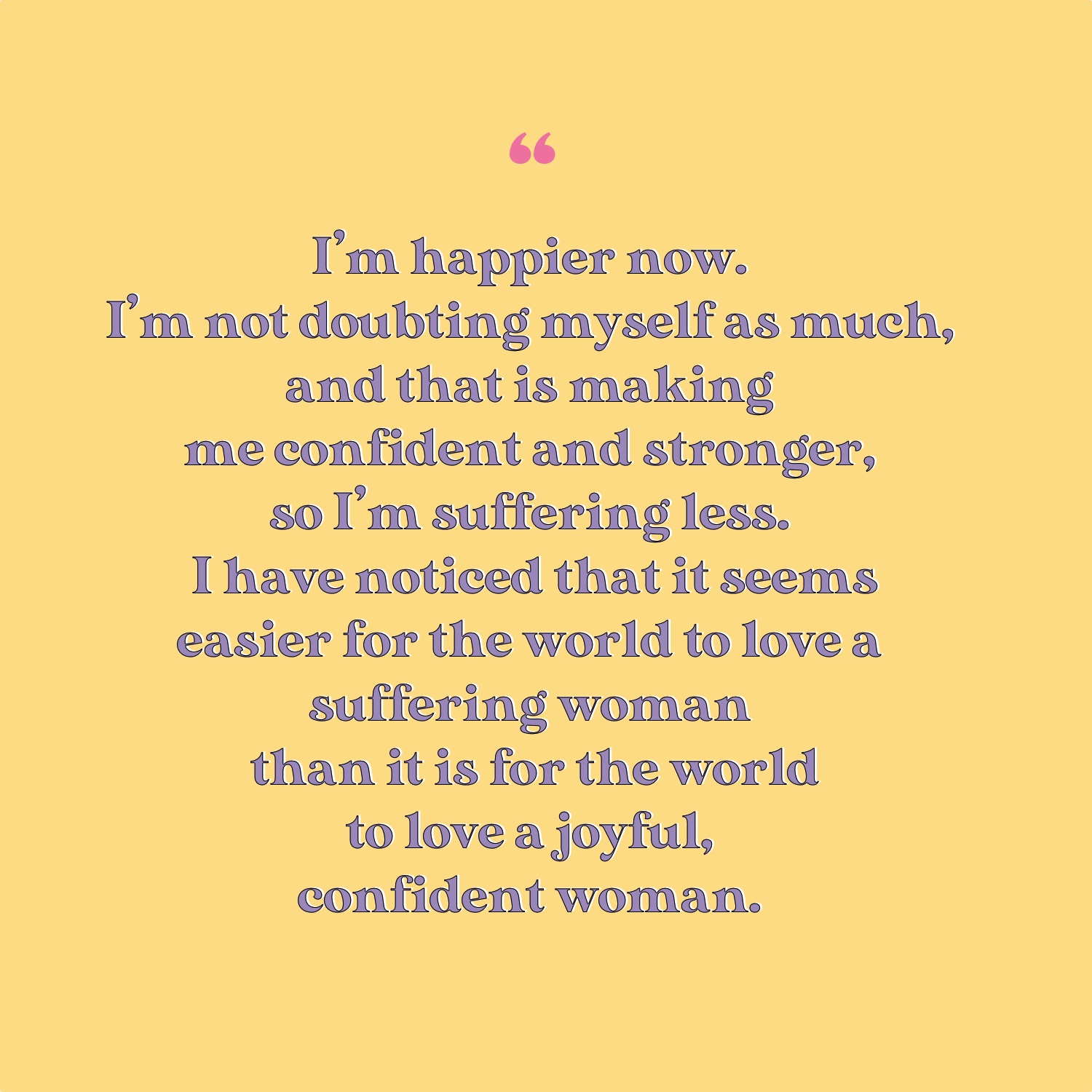Eigentlich hatte ich vor, an diesem Montag über ein neues Phänomen der Sozialen Medien zu schreiben, oder besser darüber, ob so was überhaupt existiert: die Glorifizierung von Struggle nämlich. Und zwar nur darüber. Dann kam das Leben dazwischen und mit jedem Tag ein neues Thema hinzu, an dem meine gesamte Aufmerksamkeit kleben bleib. Am Sonntag sah mein Notizbuch schließlich aus wie der Stundenplan meines Kindes und auch wie ein Schweizer Käse. Überall Löcher, also offene Fragen und rudimentäre Gedankengänge. Es gibt viel zu tun. Weshalb ich euch heute lieber mitnehme auf eine schnelle Spritztour durch die Geschehnisse und geteilten Überlegungen der vergangenen Woche.
Beginnen wir doch mit Madeleine, die ihr wahrscheinlich als @DariaDaria kennt. Vor Kurzem kaufte sie sich von ihrem eigenen Geld eine eigene Wohnung, seither lässt sie uns unter anderem am Prozess des Einrichtens teilhaben. Das freut mich und viele andere, aber die Welt wäre nicht wie sie ist, bliebe es in einem solchen Fall bei gut gemeinten Glückwünschen. Oder eben Desinteresse. Schnell folgten die kritischen, zutiefst enttäuschten Stimmen. Sogar persönliche Angriffe. „The apartment, the clothes, the happiness“ – Madeleine sei nicht mehr „relatable“ und Schlimmeres, deshalb tschau Kakao.
„I’m happier now. I’m not doubting myself as much, and that is making me confident and stronger, so I’m suffering less. I have noticed that it seems easier for the world to love a suffering woman than it is for the world to love a joyful, confident woman“, zitierte sie irgendwann die bemerkenswerte Schriftstellerin Glennon Doyle („Untamed“). Einerseits als Antwort, andererseits als Appell. Oder Denkanstoß. Um uns daran zu erinnern, dass es nicht schadet, die eigenen Empfindungen gelegentlich zu hinterfragen. In diesem Fall geht es nämlich längst nicht mehr um persönliche Wehwehchen oder darum, wer wen blöder findet oder ob hier jemandem etwas geneidet wird.
Das hatte Madeleine schon begriffen, lange bevor sie sich als Teil einer Kooperation völlig zu Recht eine glänzende Waschmaschine in ihr Dachgeschoss tragen ließ. Weshalb sie einigen der motzenden Follower*innen offenbar nicht nur in Sachen Hausarbeit einen großen Schritt voraus zu sein scheint. Es geht, zum Beispiel, um so etwas wie internalisierte Rollenmuster und Misogynie, bzw. gelernte und verinnerlichte Frauenfeindlichkeit. Und schon wieder um das Patriarchat. Dem spielt es nämlich in die Karten, dass wir dazu erzogen wurden, eher die Interessen der Männer zu vertreten, statt unsere eigenen. Dass wir gelernt haben, erfolgreiche, selbstbewusste Frauen als weniger sympathisch zu empfinden, wohingegen Erfolg dem männlichen Geschlecht rundum zugute kommt. Uns nicht. Erfolg als Makel (wo sind die Kinder??), Selbstzufriedenheit als arrogante Charakterschwäche, Glück und Geld als Gründe zu hassen – klingt schräg, ist aber Fakt, das sagt die Wissenschaft. Misogynie kann demnach als so etwas wie die Exekutive des Patriarchats betrachtet werden. Als eine der wirksamsten Werkzeuge im Kampf gegen die Gleichberechtigung überhaupt.
Zeit für einen kurzen Selbsttest: Fasst du die Aussage „Du bist wirklich nicht wie die anderen Frauen!“ als Kompliment auf? Hast du schon mal gedacht „Die stelle ich ganz sicher nicht meinem Freund/ meiner Freundin vor, so hübsch wie sie ist“? Schon mal Sachen gesagt wie „Jungs sind viel cooler, Mädchen sind so schrecklich zickig!“? Oder „Die Beauty-Tussi kann ja überhaupt nichts in der Birne haben“?
Gut, ich auch. Daran lässt sich allerdings einiges ändern.
Madeleine schreibt derweil:
„The more often I show my life now, the happy, good life I’m allowed to currently live, the more I get criticized for exactly that. Especially for successful women this creates an endless loop of guilt and shame. The thought of not deserving any of it, the thought of upsetting people who preferred the old me (I’ve even gotten messages literally saying “I want the Madeleine from five years ago back”).“
So etwas tut weh. Persönlich, wenn man selbst gemeint ist. Aber auch universell betrachtet. Weil Missstände wie diese aufzeigen, wie schwer es bis heute sein kann, Banden zu bilden. Aber ohne diese Banden, ohne den Zusammenhalt und das gegenseitige Halten und Stärken, wird es noch mehr als ein Jahrhundert dauern, bis wir echte Gleichberechtigung erlangen. Was wieder kein Geheimnis ist.
Zur Erinnerung ein Beispiel: Erst seit 1962 dürfen Frauen in Deutschland eigene Konten eröffnen und über Geld verfügen. Vergesst solche Details nie, niemals.
Wir sollten nicht nur deshalb nach wie vor vor Begeisterung grölen, wann immer eine von uns von sich behaupten kann, finanziell unabhängig zu sein. Denn auch das ist aufgrund der andauernden und strukturellen Geschlechtsdiskrimierung mitnichten eine Selbstverständlichkeit, trotz dieser opulenten Zahl 2021. Frauen werden seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen, leisten den Großteil der unbezahlten und auch der unterbezahlten Care-Arbeit, sie geraten schneller in die Teilzeit-Falle und sind durch diese und weitere Faktoren massiv von Altersarmut bedroht, Stichpunkt „Renten-Pay-Gap“. Das geschieht trotz vermeintlicher Privilegien.
Was passiert, wenn eine Frau gleichzeitig von mehreren Diskriminierungen wie Rassismus, Ableism, Klassismus oder Homophobie und Trans*-Diskriminierung betroffen ist, sollte mensch sich mittlerweile vorstellen können.
Wirklich. Applaudiert doch einfach mal statt nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Solidarisiert euch! Stärkt euch. Seid verletzlich. Reflektiert. Rudert zurück. Macht euch, wenn nötig, den Hof. Seid furchtlos voreinander. Emphatisch miteinander. Hinterfragt eure eigenen Gefühle. Macht andere groß, statt sie klein zu halten. Ist das Glück der anderen mal schwer zu ertragen, ist das nur menschlich und verständlich in diesen neuen Zeiten des Herzeigens. Drückt einfach den „Unfollow Button“ statt zum Gegenangriff anzusetzen. Das ist für beide Seiten gesünder. Auch wenn die Medien uns unter anderem durch Klatschzeitungen, durch permanentes Slut Shaming, durch Peter Pan und den Stress zwischen Wendy und Glöckchen oder das sogenannte „Schlumpfinen-Syndrom“ beigebracht haben, dass wir in Konkurrenz zueinander stehen: Nein.
Wehrt euch dagegen, auch gegen euch selbst. Es heißt ja nicht, dass wir alle Frauen dieser Erde feiern müssen, gar nicht. Frauen können selbstverständlich richtig scheiße sein. Und Arschlöcher. Aber nicht, weil sie Frauen, sondern weil sie nunmal Menschen sind. Das zu beurteilen, ob jemand uns missfällt, meine ich, sollte aber unbedingt aus den richtigen Gründen, bzw. mithilfe valider Kriterien statt durch den Nebel der mitunter giftiger Sozialisation geschehen. Denn ja, Kritik ist und bleibt ebenfalls essenziell, sonst wächst am Ende niemand mehr.
Cloudy Zakrockys Instagram Post (Tag zwei) der in Auszügen wie folgt lautet, schlägt übrigens auf gewisse Weise in die gleiche Kerbe:
„Es scheint, dass früher jede*r auf Social Media unbedingt happy sein musste und es als komisch empfunden wurde, wenn jemand zu kämpfen hatte, während heutzutage es genau anders herum zu sein scheint, und die Leute unbedingt andere strugglen sehen wollen und es wiederum komisch finden, wenn jemand einfach happy ist, vor allem in diesen harten Zeiten der Pandemie.“
Stecken wir nun tatsächlich im anderen Extrem fest? Und sollte em so sein, warum? Ich glaube erstens ja und zweitens na deshalb. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber auch, weil es uns so viel leichter fällt, Frauen zu mögen, bei denen nicht alles prima läuft. Die uns nicht dauernd toller vorkommen. Die zwar hübsch, aber dafür traurig, die erfolgreich, aber voller Makel sind. Wir begrüßen es, wenn jemand in der Welt der hübschen Bilder ausnahmsweise mal keinen unserer vom Kapitalismus befeuerten Komplexe triggert, sondern ähnlich tief in der Kacke sitzt.
Eine gesunde, beruhigende, fast rührende Entwicklung könnte das sein, denn das alles hat ja auch viel mit Empathie und Echtheit zu tun. Mit dem wirklichen Leben. Wir sollten nur aufpassen, dass wir es nicht zu bunt treiben. Das richtige Maß finden. Negative Gefühle normalisieren. Aber auch lernen, uns wieder für das Glück der anderen zu freuen. Uns unserem Inneren wieder annähern, sollten wir merken: So richtig fair sind meine Gedanken gerade nicht. Woher kommen sie? Denn meistens, das ist bekannt, verraten sie uns mehr über uns selbst als über unser Gegenüber.
Ist im Prinzip nicht so schwer, mensch muss es nur erst einsehen und dann angehen, Scheitern inklusive. Mache ich andauernd.
In Bezug auf (andere) Influencerinnen zum Beispiel. Ein Glück, dass Ida Marie Sassenberg mir einen weiteren Tag später den Kopf gewaschen hat:
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Wir wären dann jetzt auf Seite drei meines Notizbuches und noch längst nicht am Ende angelangt. Alles ist nur an- nichts zu Ende gedacht. Und schon wieder grätscht mir das (Pandemie)Leben dazwischen.
Eigentlich würde ich mich jetzt tierisch aufregen – aber ich lasse es diesmal einfach bleiben. Auch, weil ich weiß: Was ihr hierzu denkt, wird die Lücken des Schweizer Käses besser füllen als ich es allein je könnte.