Ein gutes Buch zu lesen ist für mich manchmal wie eine Tasse sehr starker Espresso: belebend. Bei Espresso lässt dieser Effekt jedoch schnell nach, was man von den Büchern, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, nicht behaupten kann – sie perlen immer noch durch meinen Körper, sirren in meinen Gehirnwindungen. Sie lassen mich Dinge hinterfragen und darüber nachdenken, was es in verschiedenen Kontexten bedeutet, als Frau aufzuwachsen. In Südkorea, in Deutschland, in Belarus.
Cho Nam-Joo: Kim Jiyoung, geboren 1982 (Übersetzung: Ki-Hyang Lee) |
Eigentlich scheint es für Kim Jiyoung prächtig zu laufen: Die 33-Jährige hat vor drei Jahren geheiratet, ist Mutter einer niedlichen Tochter geworden und lebt mit ihrer kleinen Familie in einer angemessen großen Wohnung am Stadtrand von Seoul. Bis zur Geburt ihres Kindes war Kim Jiyoung bei einer Marketingfirma angestellt, ihr Ehemann Daehyon arbeitet bei einem mittelständischen IT-Unternehmen. Doch irgendetwas stimmt nicht mit Kim Jiyoung: Sie fällt immer öfter durch sonderbares Verhalten auf, behauptet, sie sei nicht sie selbst, sondern ihre Mutter oder eine alte Studienkollegin ihres Mannes. Ist Kim Jiyoung pychisch krank? Ist sie „verrückt“? Die Antwort von Autorin Cho Nam-Joo lautet: Mit Kim Jiyoung stimmt alles – es ist die Gesellschaft, die krank ist, und die wiederum Frauen krank macht. Präzise und akribisch schreibt sie in dem Bestseller Kim Jiyoung, geboren 1982 über den täglichen Sexismus in Korea, darüber, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind und auch so behandelt werden. Darüber, wie aus vielen kleinen Dingen ein Muster entsteht, aus dem auszubrechen nahezu unmöglich ist. Anhand der Lebensgeschichte der fiktiven Kim Jiyoung erzählt Cho Nam-Joo, wie koreanische Frauen von Geburt an benachteiligt und klein gehalten werden. Da müssen die Schwestern ihrem jüngeren Bruder das Leben so angenehm wie möglich machen, schließlich bietet sich ihm, und ihm allein, eine strahlende Zukunft. In der Schule sind Mädchen einer sexistischen Kleiderordnung unterworfen und werden sexuell belästigt, später setzt sich das im Beruf fort.

Frauen sollen angenehm im Umgang und schön sein und vor allem dafür sorgen, dass es ihren männlichen Kollegen gut geht. Diese männlichen Kollegen werden für die gleiche Tätigkeit selbstverständlich besser bezahlt als ihre Kolleginnen. Sind dann Kinder da, müssen viele Frauen beruflich aussetzen oder gar ganz mit der Arbeit aufhören, weil es nicht anders geht – nur, um sich dann anhören zu müssen, sie würden sich von ihren Männern aushalten lassen. Und so weiter, und so fort. Cho Nam-Joo reichert die Geschichte einer typischen „Jederfrau“ mit Daten und Fakten an, mit all den kleinen Dingen, die zeigen: Welche Frau würde in so einer Gesellschaft nicht verrückt werden?
„Während Jungs sich ganz natürlich als Erste in die Schlange stellten, als Erste ihr Referat halten durften und ihre Hausaufgaben als Erstes kontrolliert wurden, warteten Mädchen still darauf, an die Reihe zu kommen, manchmal ein bisschen gelangweilt, manchmal erleichtert, aber niemals irritiert darüber. So wie niemand hinterfragt, warum die Nummer des Personalausweises bei Männern mit einer 1 und bei Frauen mit der Ziffer 2 beginnt.“
Mithu Sanyal: Identitti |
Mithu Sanyals Debütroman Identitti ist so knallbunt und verstörend-schön wie das dazugehörige Buchcover. Und: Er ist so aktuell, aktueller geht es kaum. Am Anfang steht ein Skandal: Saraswati, angesagte Professorin für Intercultural Studies und Postkoloniale Theorie (die wie Beyoncé keinen Nachnamen braucht, weil man einfach weiß, wer sie ist), entpuppt sich als weiße Frau, nachdem sie sich jahrelang als woman of color ausgegeben hat. Das trifft vor allem ihre 26-jährige Studentin Nivedita hart, die als Tochter einer Deutschen und eines Inders in Deutschland aufgewachsen ist und Saraswati zu ihrer persönlichen Heldin erkoren hatte. Eine Welt bricht zusammen, ein Shitstorm beginnt und schon befindet Nivedita sich mittendrin in einer Debatte über Identität und Zugehörigkeit. Wie gerne möchte sie Saraswati verurteilen, sich von ihr lossagen – so wie die anderen Studierenden und empörte Menschen in den sozialen Netzwerken. Stattdessen zieht Nivedita bei Saraswati ein und stellt ihr intime, unbequeme Fragen, nach deren Antworten sie selbst seit ihrer Kindheit sucht: Was macht uns aus? Und können wir selbst darüber entscheiden, wer wir sind? Was ist, wenn Hautfarben, Herkünfte und Identitäten nicht eindeutig sind? Identitti behandelt eine Menge wichtiger und komplizierter Themen wie Rassismus, Whiteness, kulturelle Aneignung und Leben in der Mehrheitsgesellschaft. Trotzdem fühlt er sich erstaunlicherweise an keiner einzigen Stelle behäbig oder überladen an.
Im Gegenteil: Dieses Buch macht Spaß, auch und gerade weil die Charaktere, die sich in ihm tummeln, so voller Schwächen und Fehler sind. Saraswati zum Beispiel nervt manchmal so sehr, dass man ihr ihr wichtigstes Werk Decolonize your Soul um den Kopf hauen möchte. Und Nivedita? Der möchte man empfehlen, sofort aus dieser seltsamen WG auszuziehen und endlich mal klarzukommen. Sanyal schafft es, all ihren Protagonist*innen, selbst Saraswati, mit Empathie und Respekt zu begegnen. Sie lässt ihnen Raum – Raum für Ambivalenz und Zweifel, für verschiedene Ansichten. So kommen viele Stimmen zu Wort, darunter bekannte Namen wie Kübra Gümüşay und Hengameh Yaghoobifarah (die Sanyal darum bat, extra für das Buch Tweets und Beiträge zu verfassen). Zusammen mit den Romanfiguren bilden sie ein dermaßen lautes Konglomerat an Perspektiven und Meinungen, dass es manchmal fast überwältigend ist. Und damit lebensecht, real und emotional.

„Lass mich in Ruhe mit deinen Ambivalenzen. Ich habe die letzten drei Jahre nichts anderes gemacht, als dir durch das Dickicht der Ambivalenzen zu folgen. Du warst mein moralischer Kompass und hattest in Wahrheit keinen moralischen Knochen in deinem Körper!“
Zum Weiterlesen: Für 54 Books hat Sybille Luithlen mit Mithu Sanyal über das Schreiben, race, sex und Identität gesprochen.
Volha Hapeyeva: Camel Travel (Übersetzung: Thomas Weiler) |
Seit Monaten gehen in Belarus tausende von Menschen auf die Straße, um gegen das autoritäre Regime von Alexander Lukaschenko zu protestieren. Sie prangern die manipulierten Wahlen an, sie wünschen sich mehr Demokratie, mehr Rechte. Es sind aufwühlende, emotionale Bilder, die zeigen, wie sehr diese Protestbewegung von Frauen getragen wird. Doch was wissen wir eigentlich über dieses Land, über die Frauen, die dort aufgewachsen sind und leben? Natürlich, da sind zum Beispiel die Bücher der belarusischen Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, in denen diese aus verschiedenen Stimmen Collagen des täglichen Lebens schafft. Und da ist jetzt auch das Buch einer jungen Belarusin: Volha Hapeyeva wurde 1982 in Minsk geboren, ist in verschiedenen literarischen Genres zu Hause (ihr Gedichtband Mutantengarten erschien 2020 auf Deutsch) und schreibt in ihrem autobiografisch geprägten Roman Camel Travel über das Aufwachsen in der zerfallenden UdSSR Ende der 1980er- und Anfang der 1990er Jahre. In kurzen Kapiteln erinnert Hapeyeva sich daran, wie es ist, in einem Land Kind zu sein, in dem zwei Sprachen – Russisch und Belarusisch – gesprochen werden, und in dem der Alltag viele kleine und größere Herausforderungen bietet. So hat die Mutter immer einen Pappumriss des Fußes ihrer Tochter in der Tasche dabei, schließlich sind Kinderschuhe schwer zu bekommen und sie möchte allzeit bereit sein: Geschickt schafft die Mutter es, Schuhe für ihre Tochter zu sichern, ohne dass diese sie anprobieren muss. Immer wieder klingt das Thema Emanzipation an: Die Erzählerin denkt über die Rolle von Mädchen und Jungen, von Frauen und Männern nach, und stellt Gegebenes in Frage. Das passiert wie nebenbei, oft lakonisch und mit leisem Humor: „Ich wollte mich auf keinen Fall vom Homo sapiens unterscheiden, als der natürlich nur der Mann galt, und nicht in die Kategorie ‚Frau‘ einsortiert werden. Im Fernsehen, im Theater, in der Literatur – überall wurde das Frausein als wenig erstrebenswert dargestellt.“ Camel Travel ist ein kleines, unaufgeregtes Buch, das liebevoll und detailgenau vom Aufwachsen in einem Land erzählt, das lange kein eigenständiges Land sein durfte.
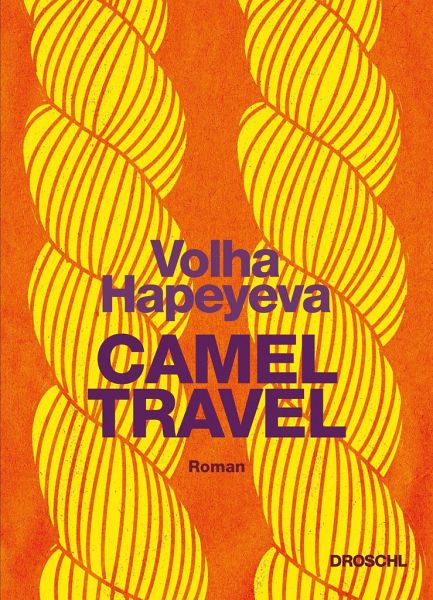
„Im Vorwort meiner Fibel wurden gleich sämtliche Prioritäten gesetzt und erklärt, wen die Kinder in welchem Maße zu lieben hätten: ‚Du lernst lesen und schreiben. Als Erstes schreibst du die Wörter, die uns allen am liebsten und teuersten sind: Mutter, Heimat, Lenin.‘ Diese Heimat war mir zu groß und abstrakt, für zusätzliche Verwirrung sorgten in meinem Kindskopf das Vorhandensein zweier Länder (BSSR und UdSSR), zweier Hauptstädte (Minsk und Moskau) und zweier Hymnen (der BSSR und der UdSSR) – um sechs Uhr früh wurde im örtlichen Rundfunk die Hymne der BSSR gespielt, schaltete man auf einen gesamtsowjetischen Sender um, hörte man die Hymne der UdSSR. Also lebten wir parallel in zwei Dimensionen oder im Bauch einer russischen Holzmatrjoschka.“


