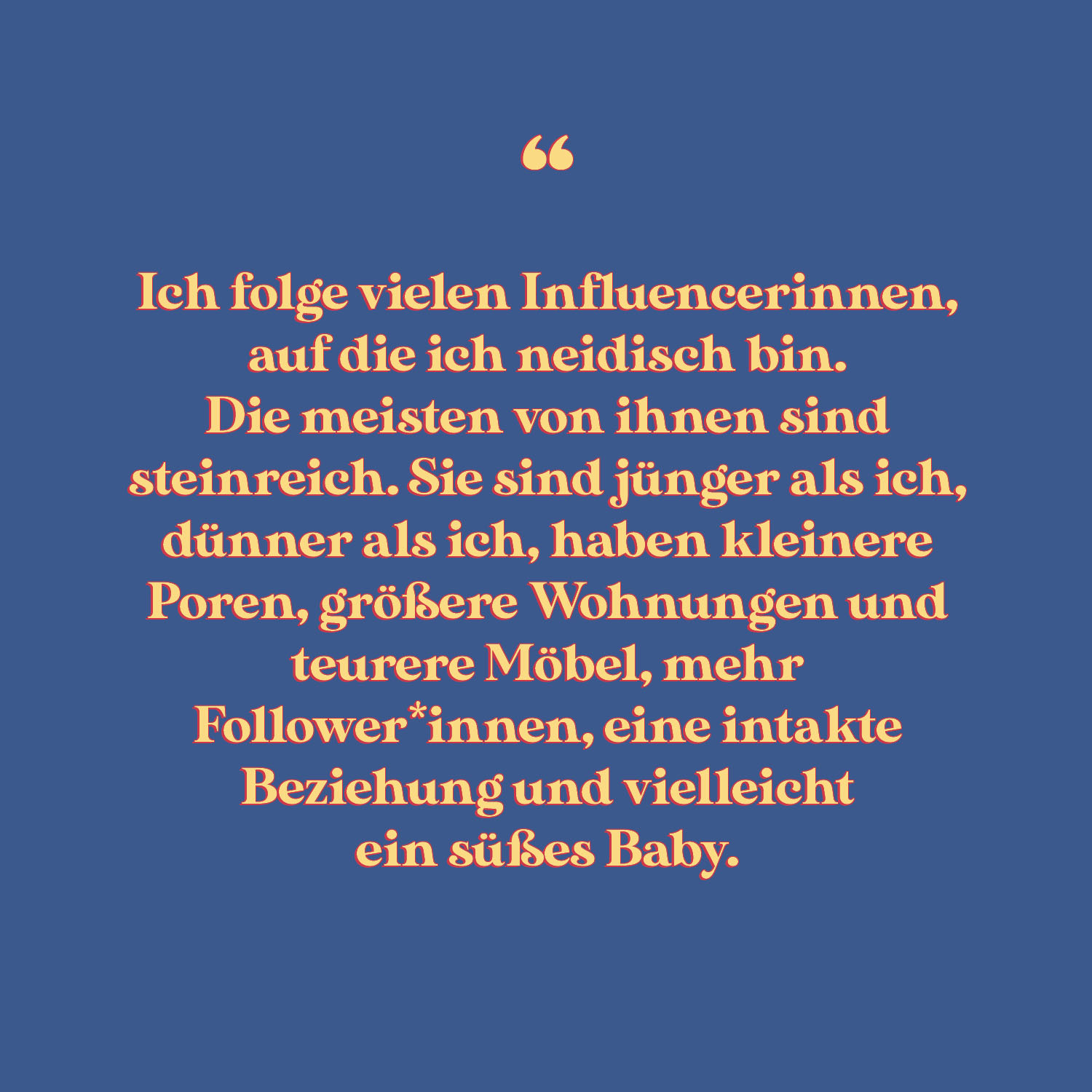Sich in sozialmedialen Räumen zu bewegen wird als freiwilliges Schicksal verstanden. „Du musst es ja nicht teilen, wenn du mit der Kritik nicht leben kannst“, lese ich immer wieder. Kritik, die von Meinungsfreiheit bis hin zur „eigenen Schuld“ der Protagonist*innen gerechtfertigt werden soll und häufig keine ist, sondern dort trifft, wo man es bislang noch nicht geschafft hat, sich ein dickes Fell anzulegen. Personen des öffentlichen Lebens brauchen dieses Fell angeblich, wenn sie schon so blöd sind und sich entscheiden, ein solches zu führen. Komisch nur, dass die Verantwortung stets bei den Rezipient*innen zu liegen scheint.
Wie vielen Accounts ich auf Instagram folge, ändert sich fast täglich. Löschen und hinzufügen ist eine ad hoc Entscheidung und passiert nebenbei. Impulsgesteuert bewegen wir uns in unserem digitalen Zuhause und bleiben eben nicht nur an den Orten hängen, die uns guttun. Das Phänomen wird unter „Hate-Watch“ zusammengefasst und beschreibt den Konsum von Content, ob fiktional oder Reality Format, der den Konsumierenden weder Freude bereitet, noch lehrreich ist. Er dient der Selbsterhebung, dem Frust ablassen und dem Austausch mit Gleichgesinnten. Ich mache das auch. Ich folge vielen Influencerinnen, auf die ich neidisch bin. Die meisten von ihnen sind steinreich. Sie sind jünger als ich, dünner als ich, haben kleinere Poren, größere Wohnungen und teurere Möbel, mehr Follower*innen, eine intakte Beziehung und vielleicht ein süßes Baby.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ich will so sein wie sie. Natürlich nicht wirklich und nicht immer. Aber in den Momenten, in denen ich zu lange hinschaue, obwohl ich schon lange weiß, dass es mir nicht guttut. Unter dem Deckmantel der Inspiration klicke ich mich durch die Story, durch alte Bilder, vielleicht den Youtube oder Ticktock Account. Dieser Prozess frisst manchmal ganze Mittagspausen oder Toilettensitzungen. Danach ist man leer, genervt oder überheblich, weil man den Link an eine Freundin geschickt hat und sich gemeinsam echauffiert, weil man sich einredet, dass die Alte auf den Bildern ohnehin alles manipuliert hat oder eine Person mit diesem Mitteilungsbedürfnis schlichtweg „kein glückliches Leben führen kann“.
Klingt ganz schön scheiße, so eine tote Zeit, so ohne Glückseligkeit und echte Aufmerksamkeit. Auch wenn wir all das längst durchschaut haben und auch wenn ich weiß, dass die neidischen Momente in der Regel schnell verschwinden, fällt, sobald ich meinen Blick von all den bunten Bildern lösen kann, auf, dass nicht alle Menschen diese Distanz und dieses Verständnis von Selbstfürsorge teilen. Ich diskutiere gerne und übe Kritik an Dingen, die mir sauer aufstoßen. Auch online. Ich sage dann „Ich finde diese Sichtweise problematisch“ oder „Es ist nicht okay, etwas so darzustellen“. Was ich nicht tue, ist meinen Unmut über die Vorteile und Lebensrealitäten anderer auf ihrem gratis online Angebot, das frei zugänglich ist, abzuladen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Es ist nicht so schwer, zwischen konstruktiver Kritik, einem guten Austausch, hitziger Diskussion oder Beleidigung, unbegründetem Unwohlsein oder internalisierter, struktureller Misogynie zu unterscheiden. All das sind Dinge, die vor allem weiblich gelesene Personen in sozialmedialen Räumen täglich erleben. Dinge, die für Menschen des öffentlichen Lebens zur Tagesordnung gehören. Gerechtfertigt durch das Argument selbst daran Schuld zu sein, alledem eine Plattform gegeben zu haben.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Zur Zielscheibe werden, weil man ein gewisses Leben mit einem gewissen Wohlstand führt, besonders gut ausschaut oder einem die Sonne aus dem Allerwertesten scheint, fußt nicht nur auf Neid. Die Tatsache, dass der Beruf der Content Creator*innen oder Inluencer*innen ein Business ist, das weiblich dominiert ist und im Kern oberflächlich, gehört auch dazu. Das Absprechen der Tatsache, dass es sich um reale Arbeit handelt, die Überheblichkeit, mit der über Strukturen und Dynamiken online gesprochen werden. Ich erinnere mich noch gut daran, wie früher in medialen Räumen abfällig über Models oder gut aussehende Frauen gesprochen wurde. Was für ein Fortschritt. Nur um sich in jeder freien Minute doch an alledem zu ergötzen, was unser Handy zu bieten hat.
Tatsächlich ist dieses Verhalten lange erlernt. Was heute Social Media macht, haben wir als Teenies in der InTouch gelesen und auf dem Pausenhof bequatscht, haben wir aufgesogen bei Explosiv und Brisant und uns kaputtgelacht, während endlich jemand, dem es strukturell gut zu gehen scheint, so richtig auf die Schnauze fällt. Wenn sich jemand scheiden lässt oder zugenommen hat, eine Affäre ans Licht kommt oder gestresst aussieht. Wir haben Haarteile, Brustimplantate und Dellen an Beinen kommentiert. Drogenabhängigkeit, Straftaten und Suizid. Zum Glück fühlen sich das Abo und der Hass-Konsum einer Influencerin viel weniger trashig an als eine ganze Folge Prominent zu gucken. „Selber Schuld“ sind dann alle trotzdem gleichermaßen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Hier haben wir ganz geschickt etwas verdreht. Selber Schuld ist nämlich nur die Person, die sich für Neid und Unmut entscheidet, statt sich zu distanzieren. Die nicht gemerkt hat, wann Schluss ist und es nicht guttut, sich selbst immer weiter hineinzubegeben in den Sumpf von Reichtum, makellosen Gesichtern, Popos und Familienfotos. Dass dieser Abstand nicht allen gleichermaßen leicht fällt, liegt ebenso auf der Hand wie die Tatsache, dass sich, je größer die Reichweite ist, umso mehr Personen eingeladen fühlen, ihren Senf hinzuzugeben, nicht aber reflektieren, was es braucht, um aus diesem Senf einen konstruktiven oder gar berechtigten Kommentar zu machen.
Ich sage Ja zu verantwortungsbewusstem Umgang mit Reichweite. Ja zur kritischen Auseinandersetzung, aber Nein zu Grenzüberschreitungen und zu der Projektion des eigenen Unwohlseins auf Menschen, die wir nicht kennen.Wenn ich eine Person beneide, die mit 25 zwei Wohnsitze auf zwei Kontinenten, einen Mercedes, einen 2 Millionen Euro Kleiderschrank und ein scheinbar erfülltes Liebesleben hat, sagt das am Ende nämlich viel mehr über mich aus als über sie. Auch wenn mich ein gewisses Maß an Wohlstand irritiert, auch wenn es nervt, dass auf Instagram so viele Menschen gleich aussehen, bin ich dafür verantwortlich, den nötigen Abstand zu wahren, meine Bildschirmzeit einzuteilen oder sie zumindest an Orten zu verbringen, die mich glücklich machen statt zu frustrieren.
Ich behaupte, dass die Energie, die wir in andere Frauen stecken, ganz andere Online-Orte viel eher gebrauchen könnten.