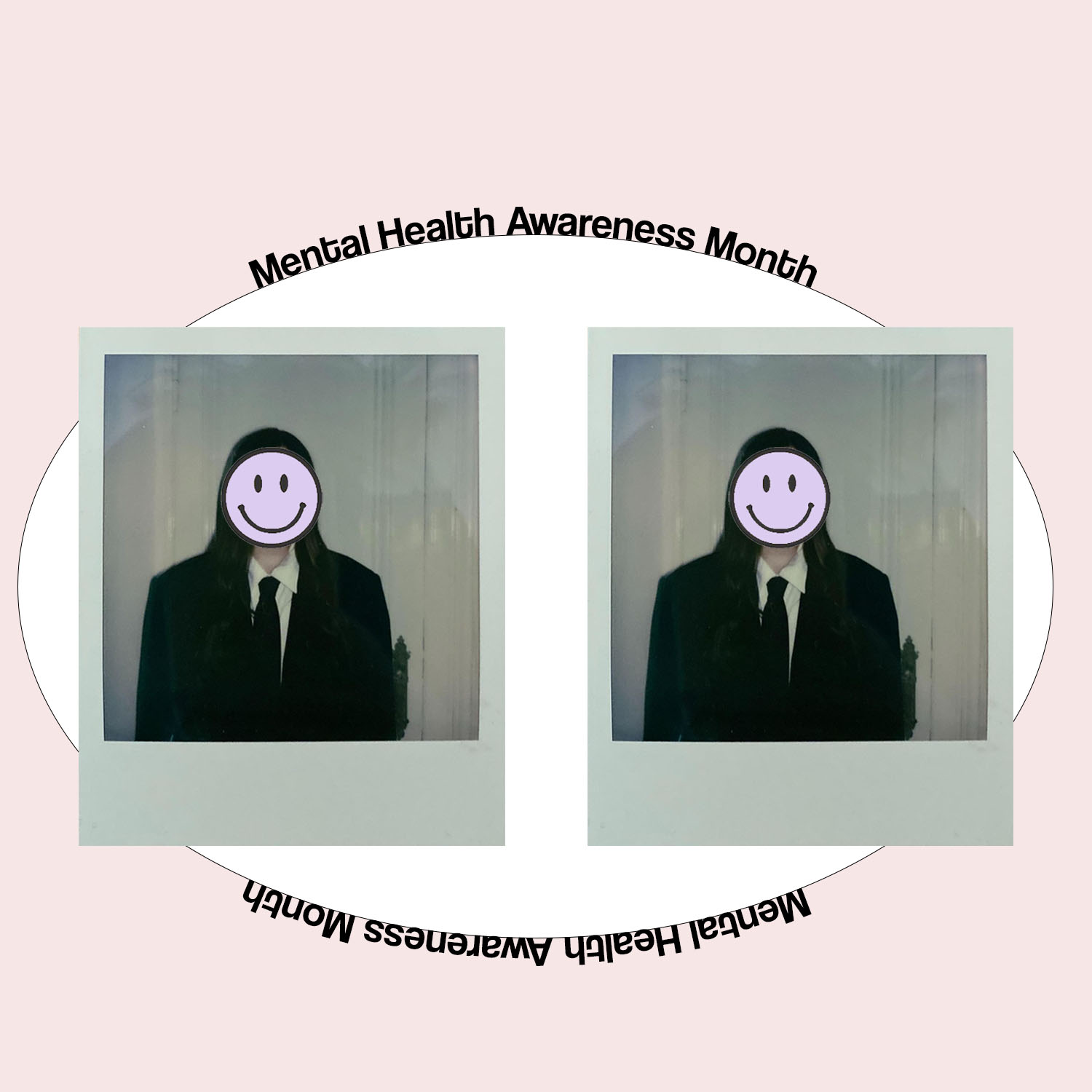Lange habe ich überlegt, was ich anlässlich des diesjährigen Mental Health Awareness Months schreiben könnte. Ich habe auf viele leere Seiten gestarrt, Ideen niedergeschrieben und anschließend wieder verworfen. Letztlich habe ich mich dazu entschieden, einen Teil meiner eigenen Geschichte niederzuschreiben, um vielleicht ein wenig dazu beizutragen, dass (insbesondere stigmatisierte) psychische Erkrankungen mehr Sichtbarkeit erlangen. Es folgt ein sehr persönlicher Text, der wohl keine Antworten, dafür aber einen Einblick in meine Gedanken gibt. Und im besten Fall gibt er zumindest einer weiteren Person das Gefühl, weniger alleine zu sein.
Triggerwarnung: Einzelne Passagen können Menschen mit Essstörungen und selbstverletzendem Verhalten triggern. Die Nummern zur Telefonseelsorge sowie der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention findet ihr im Infokasten.
Telefonseelsorge 0800-111 0 111 und 0800 – 111 0 222Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/ |
Ich habe nie an Monster geglaubt — bis ich irgendwann selbst eines sah. Zunächst war es bloß ein Schatten, doch irgendwann breitete er sich aus. Nicht unter meinem Bett, nicht in meinem Wohnzimmer, sondern in meinem Kopf. Dort, wo er mir am nächsten sein konnte. Dort, wo es ihm möglich war, mich ständig und überall zu bewachen. Anfangs tippte mich jenes Wesen, dessen Statur verzerrt und grotesk aussah, nur in wenigen Momenten an. Meist konnte ich sie an einer Hand abzählen und abschätzen, wann sie vorüber gehen würden. Mit fortschreitender Zeit passierte es häufiger, bis es mich irgendwann gar nicht mehr in Ruhe ließ.
Ich war Anfang 20, als ich die erste Liste voller Diagnosen bekam. Der Therapieraum war klein und stickig, eine Psychiaterin saß mir gegenüber, eine weitere Person schrieb Protokoll. Alle waren nett und freundlich und höflich und sahen mich mit nüchternen Augen an. Irgendwann hörte ich ihnen nicht mehr zu. Ich dachte bloß noch daran, all die Zahlen- und Buchstabencodes, die meinen Zustand vor Unwissenden verschlüsselten, am heimischen Computer zu googeln. Ich wollte alles, was dort stand, wissen und verstehen. Mein innerer Saboteur rieb sich bereits die Hände: Wissen ist Macht — und die brauchte er zum Überleben. In einer späteren Sitzung sagte mir meine Therapeutin, ich sei ausgesprochen reflektiert, würde mich, meine Gedanken und Reaktionen wirklich gut kennen und hinterfragen. Als meine Krankenkasse die Therapie beendete, war ich kein bisschen gesünder. Dafür wusste ich noch mehr über mich, meine Eigenheiten und Muster und begann das, was von meiner gesunden Psyche übrig war, zu sabotieren.

Ich jagte die wenigen Hochgefühle, die mir meine Krankheiten verschafften. Hatte ich sie gefunden, klammerte ich mich an ihnen fest, genoss jeden Moment, um sie möglichst lange in Erinnerung zu halten. Nach Höhenflügen fällt man tief, jedes Mal tut der Aufprall ein wenig mehr weh — die Schatten im Kopf erinnern dann hämisch daran, wie schön es doch eigentlich sein könnte, wenn man sich doch bloß mehr anstrengen würde. Ich glaubte ihnen, obwohl ich irrsinnig viel weinte, die Wand anstarrte, vor lauter Magenkrämpfen bloß auf dem Boden des Badezimmers liegen blieb oder meine Arme selbst im Sommer mit langen Ärmeln bedeckte.
Es gibt psychische Krankheiten, die für den Mainstream schön klingen, weil sie sich romantisieren lassen. Sie passen in Filme von Sofia Coppola, samt bodenlangen Kleidern und einem pastellfarbenen Schleier, der alles in sanftes Licht hüllt. Herzerkrankungen, Erbrochenes, verquollene Gesichter und dunkle Narben werden verschwiegen. Wer depressiv ist, steht irgendwo in einer wolkenbehangenen Landschaft, während im Hintergrund eine Indie-Ballade läuft. Meine Symptome präsentieren sich leider weniger salonfähig. Die nächtlichen Nervenzusammenbrüche, unvorhersehbaren Stimmungsschwankungen und tagelange Apathie hätten höchstens für Szenen eines schlechten Thrillers ausgereicht. Dort nämlich bringt man die unglamourösen Seiten psychischer Erkrankungen viel lieber unter. Sie gruseln, machen Angst und verstören. Sie überschatten all jene Charaktereigenschaften, die vielleicht einmal da gewesen sind. So sehr, dass auch ich mich manchmal fragte, ob meine Krankheiten wirklich bloß ein Teil von mir sind oder mich nicht doch vollends definieren.
Seit einem Jahr steht eine weitere Diagnose auf meiner Liste. Ich saß wieder in einem kleinen, stickigen Raum auf einem Stuhl, der schon ganz warm gesessen war. Damals habe ich viel aus dem Fenster geschaut, bloß in einem Moment wanderte mein Blick auf die weiße, strukturierte Tapete. Der Therapeut redete irgendwas von „stationärer Behandlung“, solle so etwas noch einmal vorkommen. Es würde nicht noch einmal vorkommen, versprach ich, wohlwissend, dass es ein Versprechen war, das ich nicht sicher halten konnte, weil es eben doch ständig wieder auftauchte, dieses Monster in meinem Kopf.
Ich musste nie in stationäre Behandlung, auch weil ich in ernsten Momenten ganz gut im Lügen war. Am liebsten belog ich mich selbst. Dann sagte ich mir, dass es so schlimm ja gar nicht sei und ich jederzeit alles unter Kontrolle bringen könnte. Meist glaubte ich mir. So fühlte sich alles leichter an. Mein Kopf, meine Gedanken, das Leben. Bis heute überbrücken meine Schwindeleien die Zeit, in der ich auf einen Therapieplatz warte. Statt neue Nummern zu wählen, E-Mails zu schreiben und jeden Tag nach Hilfe zu fragen, verdränge die Realität und warte. Von Therapiestellen — meist wegen Überfüllung — abgewiesen zu werden, fühlte sich jedes Mal wie ein Ohnmachtsgefühl an.
Manchmal möchte ich allen Menschen von meiner Psyche erzählen, um bloß endlich Tabus zu brechen, aber dann fällt mir wieder ein, dass es oft ja doch so ist, wie alle sagen und man verurteilt wird, von links und rechts und vorne und hinten. Dann schauen sie mit erschrockenen Augen oder mitleidigen Blicken, seufzen ein „ich habe es doch gewusst“ vor sich her, teilen ihr Halbwissen über psychische Erkrankungen mit oder wechseln hastig die Richtung. Statt alles auszusprechen, ziehe ich mir die Ärmel dann lieber noch ein wenig mehr über meine Arme, verdecke meine geschwollenen Wangen mit meinen Haaren und halte kurz die Luft an, wenn irgendwo der Begriff „Psycho“ fällt.
Nein, ich habe nie an Monster geglaubt — bis ich irgendwann selbst eines sah.