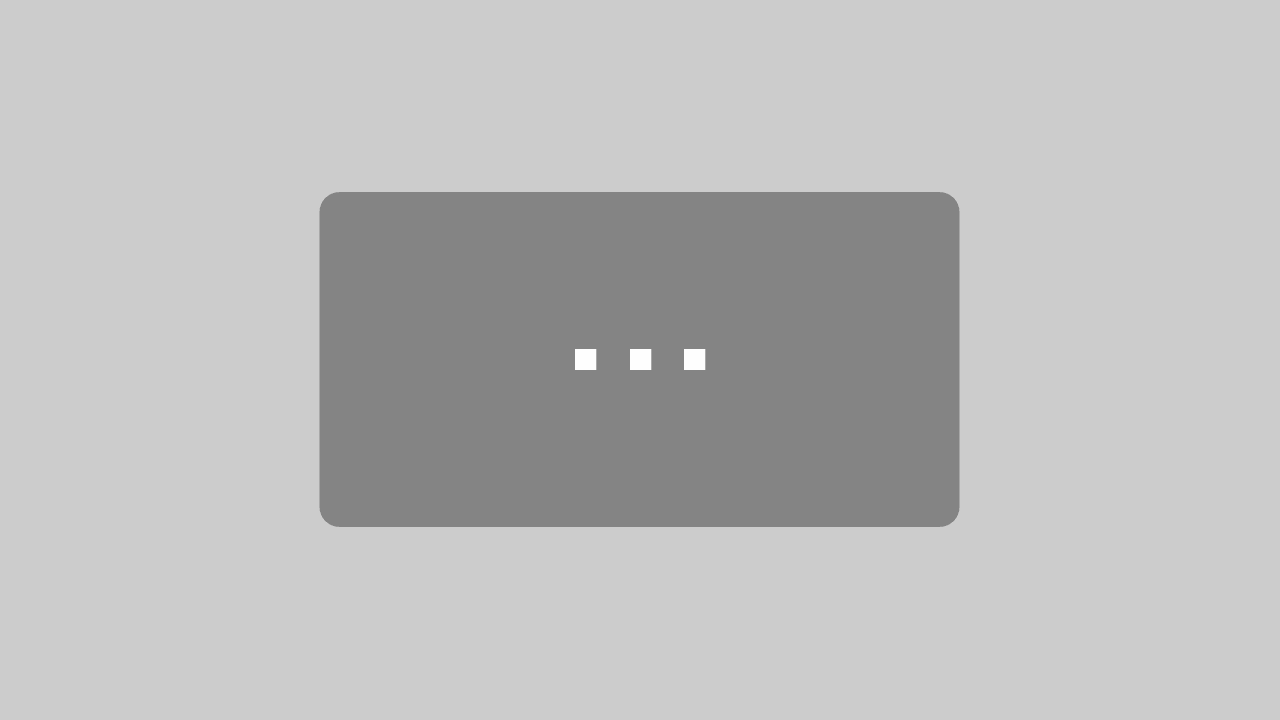Die in Berlin lebende Journalistin Kemi Fatoba beschäftigt sich mit den Themen Identität und Repräsentation – vor allem aus der Perspektive Schwarzer Menschen. „Schwarz mit großem S“ ist eine Kolumne über die Lebensrealität Schwarzer Menschen. Es ist außerdem eine politische Selbstbezeichnung, die verdeutlichen soll, dass es sich um kollektive Erfahrungen von Menschen afrikanischer und afro-diasporischer Herkunft handelt. In diesem Text geht es um mentale Gesundheit.
Schon vor der Pandemie war meine Work-Life-Balance in einer Schieflage. Sowohl meine Freund*innen, als auch meine Therapeutin einigten sich darauf, dass ich Arbeit als Ablenkung verwende. Eine Freundin ging sogar so weit zu behaupten, dass mein Urlaub nicht der Entspannung, sondern der Genesung dienen würde. Die gleiche Freundin schickte mir ein paar Wochen später mit den Worten “Das bist du!” Screenshots eines Textes zu. Er hieß: “The Rushing Woman of Colour Syndrome” („Das Syndrom der hetzenden Woman of Colour“) und wurde von den Journalistinnen Liv Little und Charlie Brinkhurst-Cuff verfasst. Die beiden sind an der Spitze des britischen Kollektivs gal–dem und erklären in dem Text (und auch in diesem TED-Talk), warum sie das “Rushing Women Syndrome” von Dr. Libby Weaver differenzierten, um explizit Women of Colour wie sie selbst zu beschreiben: Frauen, die nonstop arbeiteten und keinen “Off-Schalter” kannten.
Das Rushing Woman of Colour Syndrome – von Dauerstress, Angstzuständen und Rassismusbewältigung
Was sie beobachteten, traf nicht nur auf mich, sondern auf viele meiner Freundinnen zu: Telefone, die aufgrund von Social-Media-Benachrichtigungen und E-Mails nonstop aufleuchten; Freund*innen, die man kaum noch sah – es sei denn, man traf sie bei kulturellen Events, die man nicht verpassen wollte und Kund*innen, denen man andauernd wegen offenen Rechnungen nachlaufen musste. Weitere Merkmale waren: in überteuerten Städten zu leben, trotz Dauerstress und/oder Angstzuständen zu versuchen, irgendwie ein Sexleben zu haben und im Arbeitskontext Rassismus und Mikroaggressionen zu erleben. Da Women of Colour, insbesondere Schwarze Frauen, zusätzlich in einem höheren Ausmaß vom Impostor-Syndrom, also der irrationalen Vorstellung, trotz Talent und Qualifikationen nicht gut genug für einen Job zu sein, betroffen sind, kam dieses häufig noch dazu. Meine Freundin hatte Recht. Die Definition passte wie ein Schuh – und die Erkenntnis war zutiefst deprimierend.
Natürlich gibt es noch weitere Faktoren: der Ausnahmezustand der letzten 15 Monate, der sich in einen Dauerzustand verwandelt hatte, zum Beispiel. Unser Impostor-Syndrom wird oft von missgünstigen Menschen genährt, die uns einreden wollen, wir hätten Jobs nur der Tatsache zu verdanken, dass Diversität gerade “im Trend” ist. Gleichzeitig öffnete die sogenannte “Rassismus-Debatte” für einige wenige von uns tatsächlich für eine kurze Zeit Türen, die vorher verschlossen blieben.
Obwohl diese berufliche Anerkennung verdient und überfällig war, wurde uns jedoch immer zu verstehen gegeben, dass diese Plätze begrenzt waren, wir also in direkter Konkurrenz zueinander standen. Finanzielle Erwartungshaltungen, besonders wenn Teile der Familie nicht im Globalen Norden leben, sind oft zusätzliche Stressfaktoren, die wir mit weißen Frauen nicht teilen.
Ich bin nicht die Einzige, die sich mit Arbeit ablenkt. Wenn ich meine Freund*innen sehe, bemerke ich vor allem, wie erschöpft wir sind. Viele von uns haben die Worte “Du musst doppelt so viel arbeiten, um halb so viel zu erreichen” ohnehin verinnerlicht und arbeiten jetzt sogar mehr als vor Corona, da es kaum alternative Freizeitbeschäftigungen gibt – und weil wir es nicht anders kennen. Die Pandemie hat lediglich die Rahmenbedingungen geändert.
Depressionen, Angstzustände und Co. – Langzeitfolgen der Pandemie
Auch wenn die dunkelste Zeit des Jahres hinter uns liegt, die ständige Isolation hat ihre Spuren hinterlassen. Noch nie habe ich so viele Gespräche über Depressionen, Angstzustände, Vereinsamung und Zukunftsängste geführt wie in den letzten Monaten. Auch die Anzahl der Gespräche darüber, aus toxischen Arbeits- und Abhängigkeitsverhältnissen ausbrechen zu wollen, ist in meinem Freund:innenkreis angestiegen. Einige sind überfordert, weil sie neben stressigen Jobs mit der Kinderbetreuung alleine gelassen wurden, anderen wurde es durch die Pandemie erschwert, überhaupt jemanden kennenzulernen, mit dem man sich eine Zukunft vorstellen konnte und wieder andere haben beschlossen, sich von ihren Partner:innen zu trennen und neu anzufangen. Halbwegs gut ging es nur denjenigen, die ihre Koffer schon vor Monaten packen konnten, um der Tristesse des Lockdowns in der Stadt zu entfliehen und an Zweitwohnsitzen oder an einsamen Stränden Social Distancing betreiben konnten – ein Luxus, den nur wenige hatten.
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 31, 2021
Als die Tennisspielerin Naomi Osaka vor kurzem Geldstrafen in Kauf nahm, weil sie bei einem Grand-Slam-Turnier keine Interviews geben wollte und sich kurze Zeit später aufgrund von Depressionen völlig aus dem Wettkampf herauszog, erntete sie Kritik. Sie brachte aber auch eine wichtige Diskussion darüber in Gang, dass es weder normal noch erstrebenswert ist, alle Warnsignale zu ignorieren und ständig mit einem leeren Tank zu fahren. Die Entscheidung, in einer Gesellschaft, die Selbstaufgabe, Selbstausbeutung und Burnouts fördert, mentale Gesundheit zu priorisieren, verdient den vollsten Respekt.
Um dem Rushing Woman of Colour Syndrome entgegen zu wirken, habe ich deswegen beschlossen, öfter “Nein!” zu sagen und die Konsequenzen in Kauf zu nehmen – denn Frauen, insbesondere Women of Colour, die Grenzen ziehen, machen sich nicht besonders beliebt. Es dauerte auch nicht lange, bis ich deswegen als irrational und wütend bezeichnet wurde. Das alte Klischee eben. Die Irrationalität wurde mir im beruflichen Kontext unterstellt und Wut im romantischen – ausgerechnet von einem Ex-Freund. War mir aber egal, denn es fühlte sich gut an, unnötige Stressfaktoren zu reduzieren und “bei mir zu bleiben”, wie meine Therapeutin es gerne nannte.