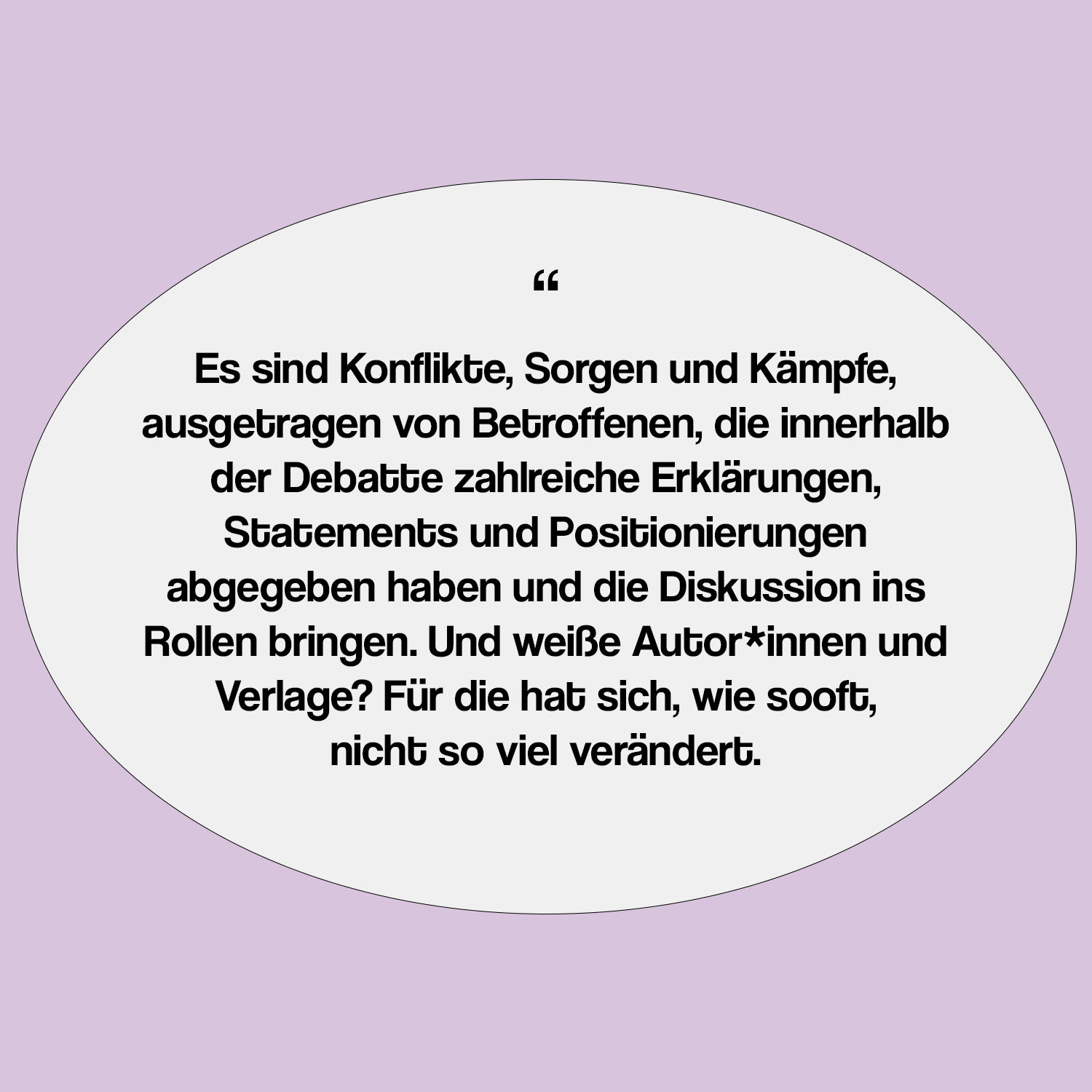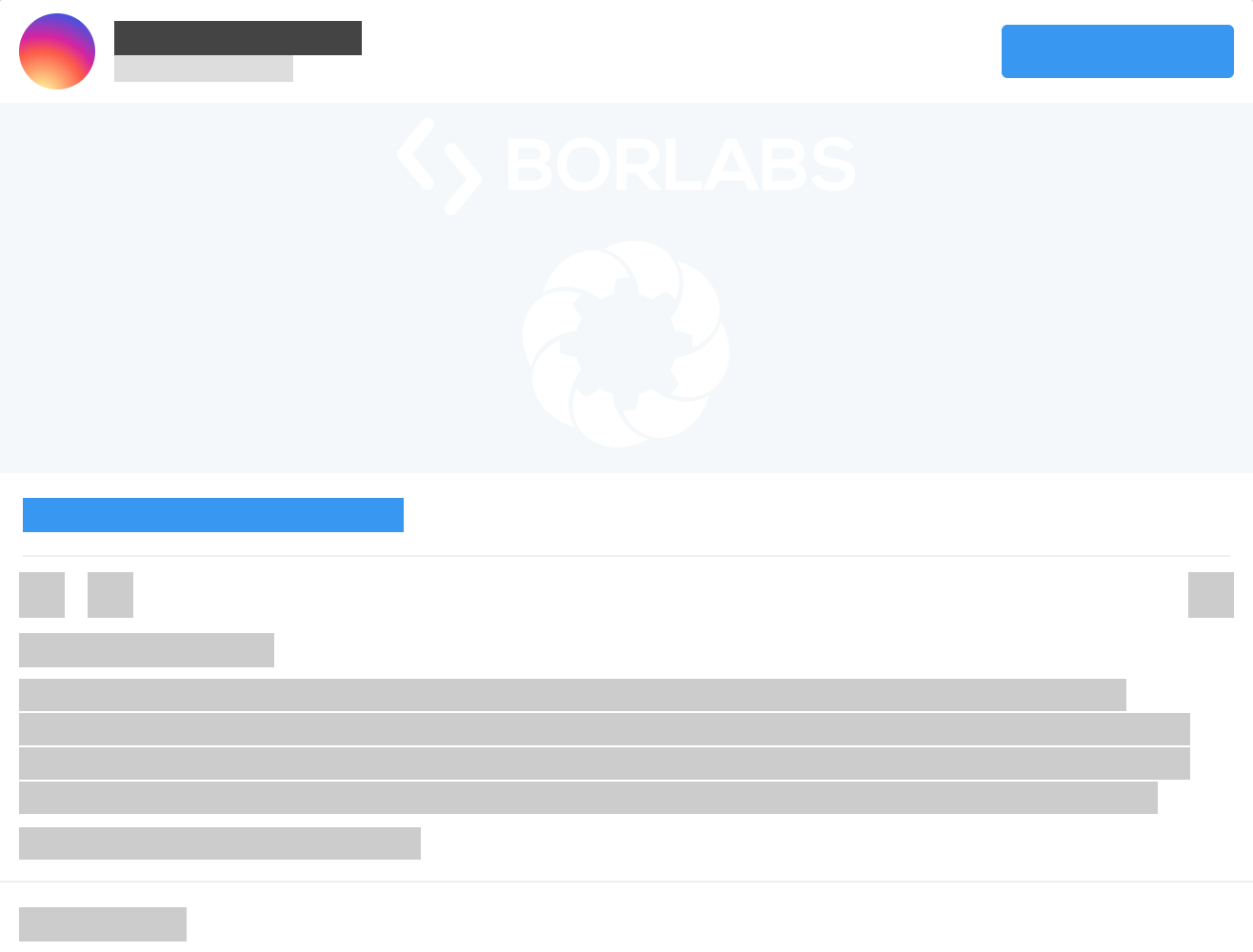Frankfurter Buchmesse 2021: Ein rechter Verlag nimmt inmitten der Traditionsveranstaltung nicht zum ersten Mal Raum ein. Autor*innen wie Jasmina Kuhnke, Ciani Haoeder und Annabelle Mandeng nehmen aus Sorge um die eigene Sicherheit und Solidarität nicht mehr Teil. Einige entscheiden sich hingegen, trotz des unsicheren Raums, bewusst dazu, ihre Arbeit zu präsentieren. Es sind Konflikte, Sorgen und Kämpfe, ausgetragen von Betroffenen, die innerhalb der Debatte zahlreiche Erklärungen, Statements und Positionierungen abgegeben haben und die Diskussion so ins Rollen bringen. Und weiße Autor*innen und Verlage? Für die hat sich, wie sooft, nicht so viel verändert.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Veranstalter*innen der Frankfurter Buchmesse ein mehr als zweifelhaftes Verständnis von Meinungsfreiheit proklamieren. Bewusst wurde in dieser Entscheidung übergangen, dass nicht-weiße Menschen Gewalterfahrungen machen. Bewusst wurde ignoriert, dass in diesem Jahr so viele Schwarze Autor*innen wie nie mit ihren Werken auf der Messe vertreten gewesen wären. Ein schlichtes Ausladen des rechten Verlags sei aufgrund der gezahlten Standmiete und der potenziellen Möglichkeit einer Klage gegenüber der Veranstaltung nicht so einfach, heißt es − in einer Demokratie müssen also Rassismus, Sexismus und Antifeminismus ausgehalten werden, sofern auch die Gegenseite ihren Raum erhält. Eine schräge Rechnung, die missachtet, dass es sich innerhalb demokratischer Wertverhältnisse hier nicht um politische Einstellungen, sondern um die Gefährdung von Grundrechten handelt. Wie also umgehen mit einer Veranstaltung, die neben dem Auftreten rechter Verlage auch immer wieder die Verhandlung ihrer Legitimität denen überlässt, die genau solche Räume einnehmen sollten, statt sie aus Angst oder Solidarität zu meiden?
Wie sooft bleibt die Verhandlung der Thematik nicht nur an denen mit Expertise, sondern auch an denen mit Betroffenheit hängen. Ein Armutszeugnis, wenn auch ein Katalysator für gesellschaftliche Veränderung, wie wir aus der Vergangenheit gelernt haben. Während Positionierung, Protest oder Solidarität nämlich vor allem von denen angebracht wäre, die auch so schon überaus problemlos Räume einnehmen und besetzen können, sehen viele weiße Autorinnen und Verlage sich nicht in der Verantwortung. Ein Status quo, der die Aufmerksamkeit auf die Entscheidung derer lenkt,
die sich aktiv wehren müssen oder wollen. Ein Status quo, der für marginalisierte Gruppen und Individuen mehr als unbequem sein kann. Als gute Schwarze, böse Schwarze werden sie im Ringen um Positionierungen, was oftmals in viel intimeren Räumen als den sozialen Medien stattfindet, deklariert. Schwarze Solidarität fängt nämlich nicht erst dort an, wo man sie öffentlich proklamiert. Wenn Kandidatin 1 aus Angst nicht teilnimmt, ist es mehr als ein politisches Moment, sich zu solidarisieren. Es ist schnell ein sensibles Moment des Mitgefühls, des Hineinversetzens und des geteilten, potenziellen Schicksals, in einem durch Rassismus zersetzen Land.
Wer wo wie viel Raum einnehmen kann, ist nämlich weder auf der Buchmesse noch in anderen Alltagsorten in Deutschland selbstverständlich. Das wissen vor allem diejenigen, von denen oft mehr Partizipation eingefordert wird, die sich dabei zugleich aber weder wohl noch sicher fühlen.
Die Kunst innerhalb dieser Debatten und Kämpfe liegt darin, Respekt vor den anderen Positionen zu wahren, ohne als Außenstehender ein „wir und sie“ zu manifestieren. Der Kampf um Demokratie und gleichberechtigte Freiheit kann nämlich nie nur der einer einzelnen Gruppe sein. Nein, er sollte sogar so fest in uns verankert sein, dass eine Teilhabe entweder für alle oder niemanden möglich ist.