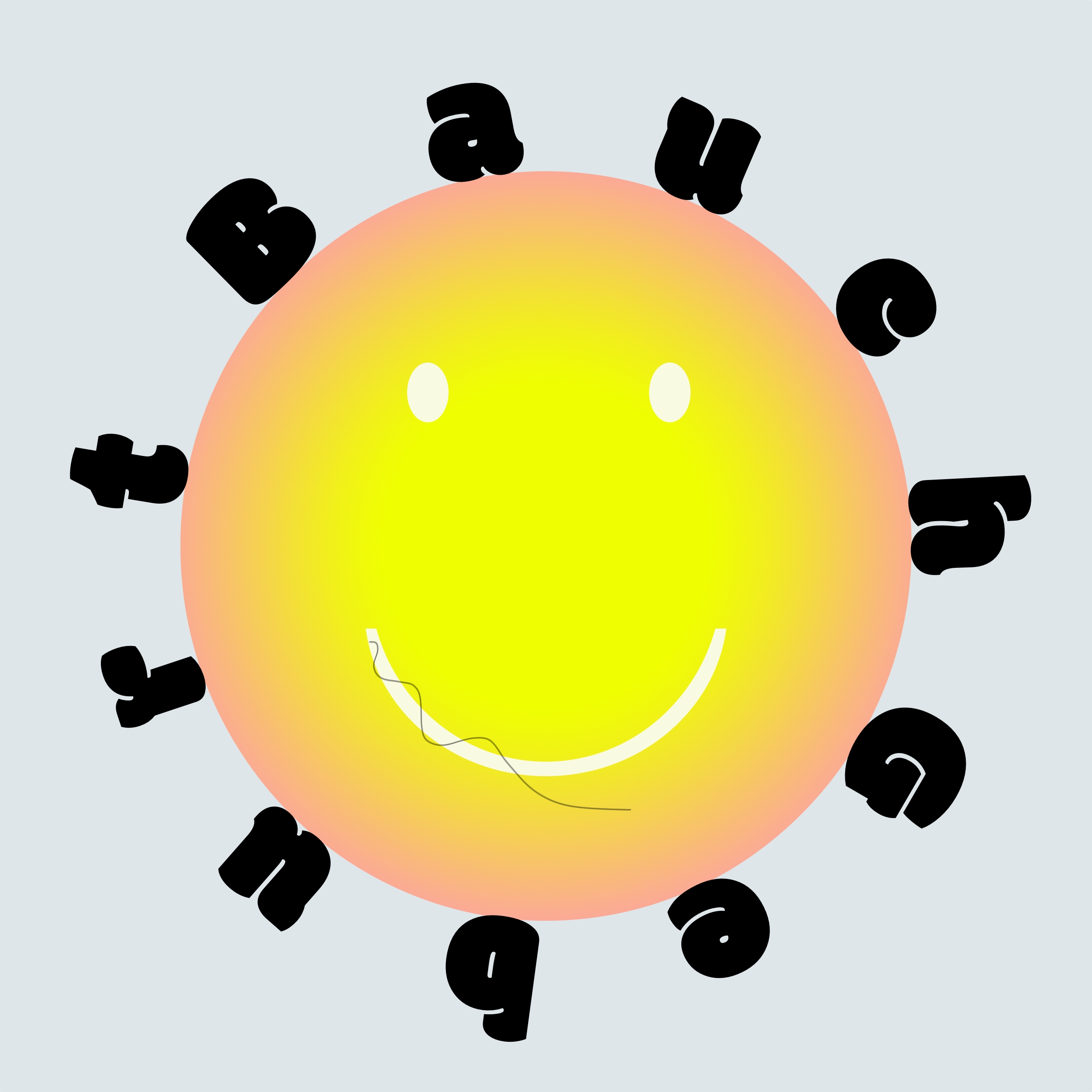„Geht los!“, schrie irgendwer durch den Flur, aus dem ich gerade gekommen und dessen Deckenleuchte ich für das Licht am Ende des letzten Tunnels gehalten hatte. Dann versank ich im Tiefschwarz der Narkose. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich erstens nicht gestorben und zweitens frisch gebackene Mama eines kleinen, fast durchsichtigen Babys, das alle zwei Stunden mit einer Spritze gefüttert werden musste und erst nach Tagen zum ersten Mal blinzelte, sekundenkurz. Dann schlief es sich groß.
Benötigen Sie psychologische Unterstützung wegen des Not-Kaiserschnitts?, wollte man noch vor Ort wissen. „Nein danke, wirklich nicht“, lautete meine Antwort, obwohl ich noch nicht einmal die Frage verstand.
Im September 2014 war ich 26 Jahre alt, hatte noch kein einziges Buch über Elternschaft gelesen, keinen Geburtsvorbereitungskurs besucht und außerdem noch keine Babys im engsten Freundeskreis zu verzeichnen.
Dementsprechend hatte ich also auch absolut keine Ahnung. Nicht davon, was es bedeuteten würde, Eltern zu werden einerseits. Andererseits aber auch nicht davon, was es heißt, in dieser Gesellschaft Mutter zu sein: Let the Dauerbewertung begin.
Es fängt oft schon bei Bekannten an, die unbedarft von „normalen“ statt von „vaginalen“ oder „spontanen“ Geburten sprechen, und endet dort, wo Menschen mit Uterus, die sich freiwillig für einen Kaiserschnitt entscheiden, stigmatisiert, bedauert und bewertet werden. „My body, my rules“ taugt für viele eben doch nur als geschmackloser Kaffeetassen-Aufdruck. Was umso tragischer ist, als dass am Ende wieder jene am meisten unter dem Urteil der Öffentlichkeit leiden, die aufgrund von medizinischen Indikatoren überhaupt keine andere Wahl hatten. Die sich im schlimmsten Fall in einer Art Schock befinden, weil sie schlichtweg überrumpelt worden – und zwar auch aufgrund mangelnder Aufklärung. Obwohl jedes 3. Kind in Deutschland durch eine sogenannte Sectio zur Welt kommt, werden in Geburtsvorbereitungskursen häufig nur die Risiken einer solchen OP besprochen, nichts weiter – eine Leerstelle, die an Fahrlässigkeit grenzt. Kaum etwas ist für Menschen, die gerade zu Eltern werden, so wichtig wie mentale Gesundheit.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Mein erstes Kaiserschnitt-Kind, meine Bauchgeburt, ist jetzt fast acht Jahre alt und ruft Mami!, wenn es Fragen, Wachstumsschmerzen oder geniale Einfälle hat. Zwar ist alles besser als Mutti, aber ehrlich gesagt kann ich mich bis heute mit keiner einzigen der gängigen Bezeichnungen für M ü t t e r identifizieren; es ist, als hätte es sich die deutsche Sprache insgeheim zur Aufgabe gemacht, „Mutterschaft“ durch aberwitzige Wortmelodien untrennbar mit einer gewissen Kälte, Einfältigkeit oder Fremdbestimmung zu behängen, je nachdem. Versteht mich nicht falsch, ich bin der deutschen Sprache für gewöhnlich durchaus zugewandt. Aber manch eine Entgleisung ist schon erstaunlich: „Wie könnt ihr ein solch zartes Geschöpf allen ernstes S c h m e t t e r l i n g rufen, echauffierte sich einst Stefano, der italienische Gasthausbesitzer, der mir unter der toskanischen Sonne „La Farfalla!“ beibrachte und dabei verliebt auf bunte Falter schaute. Wer will es ihm verdenken.
Oder das englische MOTHERHOOD – es strahlt so viele Stärke aus. Aber Mutterschaft? Wow. Ein Wort wie Schmirgelpapier.
Schenkt man den gängigsten Thesen Glauben, liegt der hierzulande meines Erachtens nach etwas speziellere, anstrengende und kritische Umgang mit Frauen und ihrer angeblichen Bestimmung zwar nicht in der Sprache, aber womöglich in der Vergangenheit begründet: 2001 etwa demontierte die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken in ihrem Buch „Die deutsche Mutter“ eine vom Nationalsozialismus geprägte Mutterschaftsideologie, die bis heute nachwirkt:
„Seit dem Kriegsende ist viel Wasser den Rhein heruntergeflossen. Deutschland ist allen Sonder- und Abwegen seiner Geschichte zum Trotz ein Land mit westeuropäischen Zivilisationsstandards geworden. Die deutsche Mutter ist einer der wenigen Sonderwege, auf denen man glaubt, weitergehen zu müssen.“
Als sei der große Muttermythos, dessen Tentakel ebenfalls bis ins Jetzt reichen, nicht schon genug Last, die noch immer zu tragen ist:
Während der Französischen Revolution etwa besaß Jeanne-Marie Roland die Unverschämtheit, außer Mutter auch Frau und Politikerin sein zu wollen. Die Rechtfertigung für ihre Hinrichtung:
“Sie war Mutter, doch sie hatte die Natur vernachlässigt, indem sie sich über sie erheben wollte.“
Lange her? Offenbar nicht lang genug. Heute rollen die Köpfe zwar nicht mehr, aber sie rauchen: Bin ich eine gute Mutter? Und gebe ich wirklich alles?
Gäben wir alles, bliebe selbstverständlich nichts mehr von uns übrig. Das wissen wir, weil es manchen von uns tatsächlich passiert: Sie verschwinden. Trotzdem klebt das schlechte Gewissen an nicht wenigen Müttern wie alter Kaugummi – weil sie meinen, nicht genug zu sein, nicht genug zu tun, nicht genug zu schaffen. Oder versagt zu haben. Wegen dem, was die Leute sich erzählen. Wegen dem, was wir gelernt und niemals mehr verlernt haben. Wegen der PDA, die vermieden werden wollte. Oder wegen der neuen Narbe, die vielleicht ewig von verpassten Erinnerungen erzählen wird.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Weil der hartnäckige Irrglaube des herbei phantasierten Scheiterns sooft schwerer wiegt als jede Ratio, ist er längst zum kollektiven Hintergrundrauschen geworden.
Und obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, habe ich dieses schmerzhafte Rauschen schon mehrmals vernommen. Kurz, aber dafür intensiv: Beim leisen Gedanken an das Abstillen. Beim ersten Glas Wein nach dem Abstillen. Beim lauten Weinen. Beim Vermissen des Davors. Beim Arbeiten danach. Immer dann, wenn ich etwas für mich ganz allein tat.
Weil auch ich inzwischen zu viel gehört, gelesen und internalisiert habe. Zu viel Unsinn wohlgemerkt.
Zwar hat der Hashtag #MomGuilt längst dazu beigetragen, das omnipräsente „Unwohlsein der (modernen) Mütter“ aus dem Tabu rüber in die Sichtbarkeit zu rücken. Fortgehen will es dennoch nicht.
Erinnern wir uns deshalb für einen kurzen Moment daran, weshalb von #DadGuilt nur sehr selten bis nie die Rede ist. Könnte es etwas mit dem allgegenwärtigen Märchen zu tun haben, Care Arbeit sei exklusiv in die DNA des weiblichen Geschlechts eingeschrieben? Natürlich. Denn ernsthaft von veralteten Rollenbildern abzulassen statt sie bloß zu enttarnen, gestaltet sich schwieriger als gedacht.
Ich möchte deswegen allen hier Mitlesenden unbedingt den ebenso erleuchtenden wie heilsamen Instagram Account Seiten.Verkehrt empfehlen – er „dreht Klischees und sexistische Muster nämlich einfach um“ und macht damit sehr, sehr deutlich, wie ulkig und traurig und absurd der Status Quo noch immer ist.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ein Beispiel: Solange Working Dads noch immer keine Elternsprecher mit Klassenkasse werden oder Powermänner in der Wirtschaftswoche von ihrem Spagat zwischen Kind und Karriere berichten, habe ich wirklich nichts als ein müdes Lächeln für Begriffe wie Working Mum oder Powerfrau übrig.
Und damit zurück zu einem besonders abscheulichen Cocktail aus gesellschaftlichem Druck, erlernten Mythen und innerer Zerrissenheit, der den Kaiserschnitt zu einer Art besoffenem Superlativ des Schuldgefühls anschwellen lässt.
Logisch: Liest man Kommentare, Artikel und Foren zum Thema, könnte man fast meinen, das übergeordnete Ziel einer Schwangerschaft sei nicht etwa das zur Welt Bringen eines neuen Menschen – sondern das möglichst schmerzmittelfreie Gebären. Als gäbe es dafür Sonderzahlungen vom Staat aufgrund besonderer Leistungen. Oder Applaus vom Baby.
Wundert sich eigentlich überhaupt noch jemand über all die Tonnen voll Rotz und Wasser, die von Kaiserschnitt-Müttern geweint werden, weil dann doch alles anders kam als gedacht? Oder ganz bewusst anders gewollt wurde als von vielen erwartet?
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
„Zwischen der sexy Schwangeren und der gut gelaunten, frisch gebackenen Mutter liegt im besten Fall eine natürliche Geburt ohne PDA oder Medikamente. Die Geburt ist am intimsten, wenn sie zu Hause – besser noch im Wald oder Wasser stattfindet. Die Überhöhung der Natur spielt in der Schwangerschaft eine große Rolle. In einer Welt, in der sich Menschen beim kleinsten Kopfschmerz Tabletten in den Organismus jagen, sollen Mütter bitte Tee trinken und ihre innere Kraft mobilisieren, um den Schmerz wegzuatmen.“, schrieb Jule Lobo neulich in ihrer aktuellen Kolumne aus der Reihe 21st Century Mom.
Und fand damit Worte für etwas, das ich bisher nur schlecht verbalisieren konnte: Nichts gegen die Natur, aber die Überhöhung derselben geht leider allzu oft mit der Überhöhung fremder Meinungen einher.
L’enfer c’est les autres – die Hölle, das sind die anderen. Wusste ja schon Jean-Paul Sartre.
Ich hingegen wusste vor meinem ersten Kaiserschnitt wie gesagt absolut rein gar nichts. Das ist wichtig, denn ich bin mir sicher: Genau deshalb empfand ich auch im Nachgang nichts Negatives – nur Erleichterung und Dankbarkeit. Von allein wäre ich jedenfalls nicht auf die Idee gekommen, irgendetwas Essentielles verpasst zu haben. Ich dachte bloß: Glück im Unglück gehabt. Immerhin blieben mir die Geburtsschmerzen erspart.
Mit einem bis zuletzt unentdeckt gebliebenen HELLP-Syndrom hatte ich mich außerdem für eine ordentliche Portion Mitleid qualifiziert – aber Mitleid wofür eigentlich? Fürs Versagen? Als Frau, als Gebärende, als Mensch, dessen angebliche Bestimmung es sein soll, einen kompletten Säuglings-Körper anstands- und alternativlos durch die Vagina ins Leben zu pressen? Was für eine Scheiße.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ich hoffe, dass ihr, die ihr nicht vaginal gebären könnt oder wollt, und deshalb oder dennoch Angst habt – vor der OP, vor dem Urteil der anderen, vor den Schuldgefühlen und davor, nicht genug zu sein – in jeder Sekunde wisst, dass ihr so wie ihr seid ganz genau richtig seid.
Dass ihr euch nicht rechtfertigen müsst, nicht schämen, nicht erklären. Dass ihr das alles schafft. Weil eure Körper wirklich große Wunder sind. Weil ihr Hilfe bekommt. Weil eure Babys nicht weniger wunderbar werden. Und vielleicht auch, weil ihr ganz bestimmt nicht allein seid mit euren Sorgen, die ohne all die abfälligen Kommentare, verurteilenden Fragen und vorwurfsvollen Blicke vermutlich noch nicht einmal da wären. Eine Bauchgeburt ist eine richtige Geburt, vergesst das nicht. Weil es gar keine falsche gibt. Nur falsche Erzählungen. Vom „einfachen Weg“ zum Beispiel. Dabei ist die Bauchgeburt nur ein Weg von vielen, euer Weg, der einzige.
Auch mein zweites Kind wurde vor vier Monaten durch meinen Bauch auf die Welt geholt. Diesmal geplant, gut vorbereitet, bewusst, ganz sanft und warm und selbstbestimmt. Eine „Kaisergeburt“, bei der nach dem Schnitt kein Sichtschutz mehr nötig ist. Nur die Nabelschnur konnte ich am Ende vor lauter Aufregung nicht selbst durchtrennen.
Zwar ließ ich mehr oder weniger das Schicksal entscheiden, weil ich bis zuletzt nicht vollends von der Idee loslassen konnte, mithilfe einer Walking-PDA und Lachgas eine vaginale Geburt wie einen LSD-Trip zu erleben, aber das Kind verharrte seelenruhig bis zum gesetzten Termin, den ich schließlich unbedingt wahrnehmen wollte. Das Warum ist irrelevant, Gründe gibt es viele. Und bereut habe ich meine Entscheidung keine Sekunde.
Denn obwohl viele meiner Freundinnen sich heute nicht mehr an das erinnern können, was sie mir nur wenige Stunden nach ihren Spontangeburten berichteten, kann ich bis heute kein einziges Wort davon vergessen. In meiner eigenen Brust schlagen nicht zuletzt deshalb zwei sich gegenseitig zutiefst respektierende Herzen:
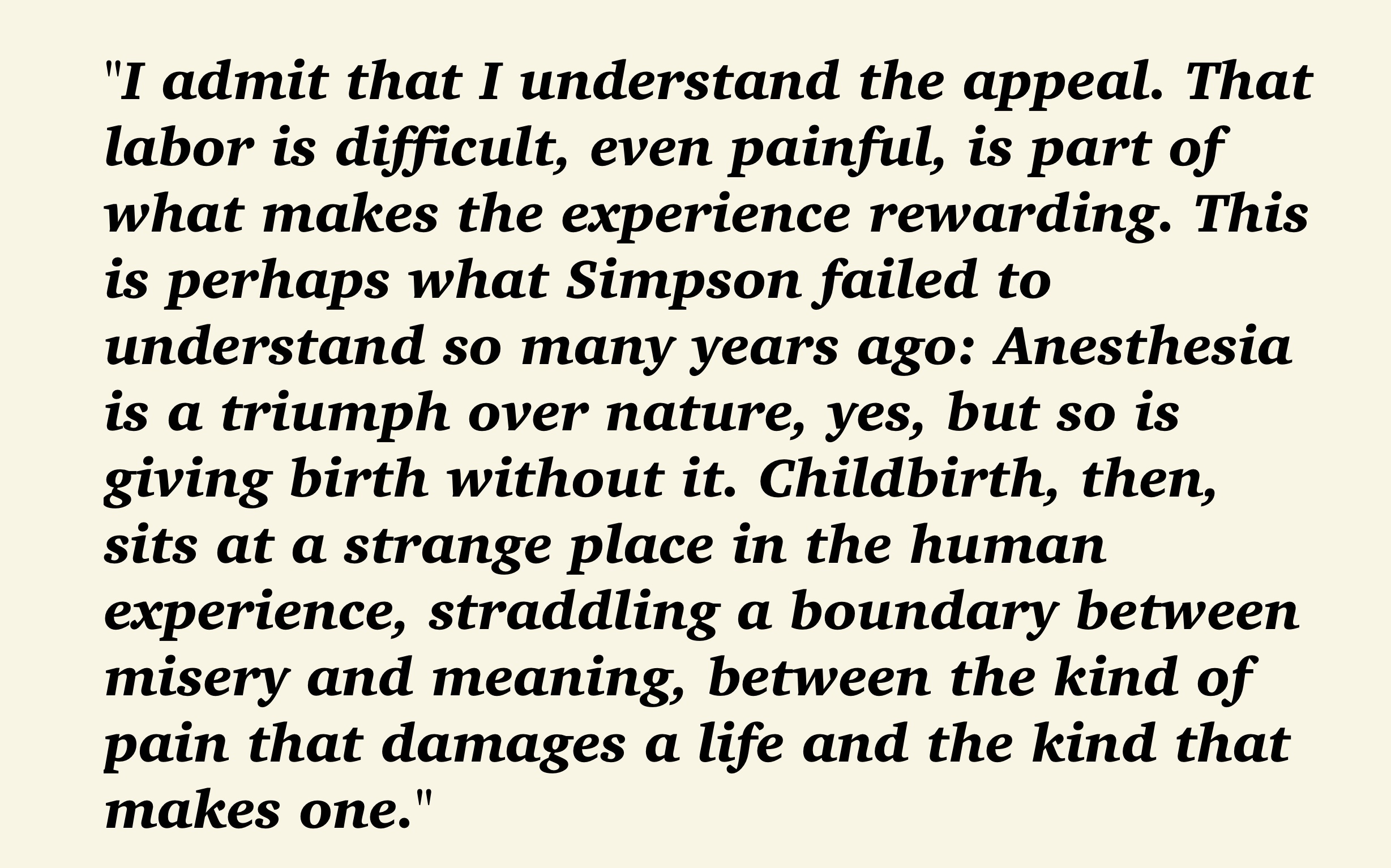
Aus dem Essay „The Pain That Is Unlike All Other Pain“ von Stephanie M. Murray für The Atlantic.
Ganz ohne Schmerzen kommt aber auch ein Kaiserschnitt nicht aus. Zwar zwicken die dazugehörigen Narrative der Unzulänglichkeit oft mehr als der Eingriff selbst. Heilen müssen wir aber alle.
Auch von den Wunden, die im Grunde gar nicht uns gehören. Bei mir hat der Prozess diesmal schon früher, nämlich vor dem eigentlichen Eingriff, begonnen. Mit einem Wort, das mir meine Hebamme beibrachte: B a u c h g e b u r t.
Wie sehr ich mich über diese Feinheit gefreut habe, über eine Beschreibung, die sich schlussendlich passend anfühlt. So nahbar und sanft. Weil sie so liebevoll und vollkommen klingt. Endlich habe ich auch dem großen Kind erklären können, dass es nicht „nicht natürlich oder normal“ geschlüpft ist, sondern im Gegenteil, absolut perfekt. Als meine erste Bauchgeburt, die uns beiden vor fast acht Jahren das Leben gerettet hat.
Es wird niemals egal sein, wie wir gebären. Es darf nicht egal sein. Aber es muss anderen egal sein.
Am Ende eint uns ohnehin das Muttersein.
Und das allein ist schwer genug.